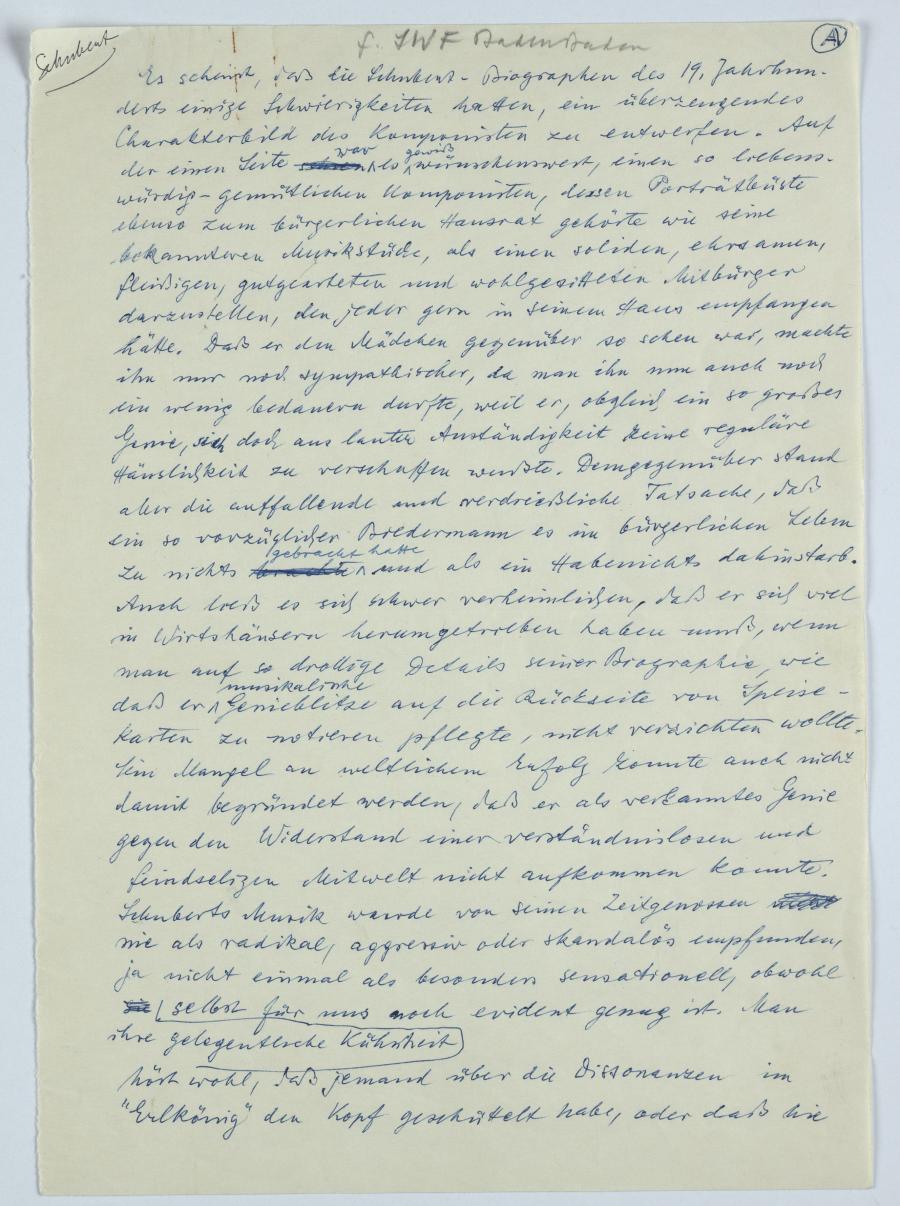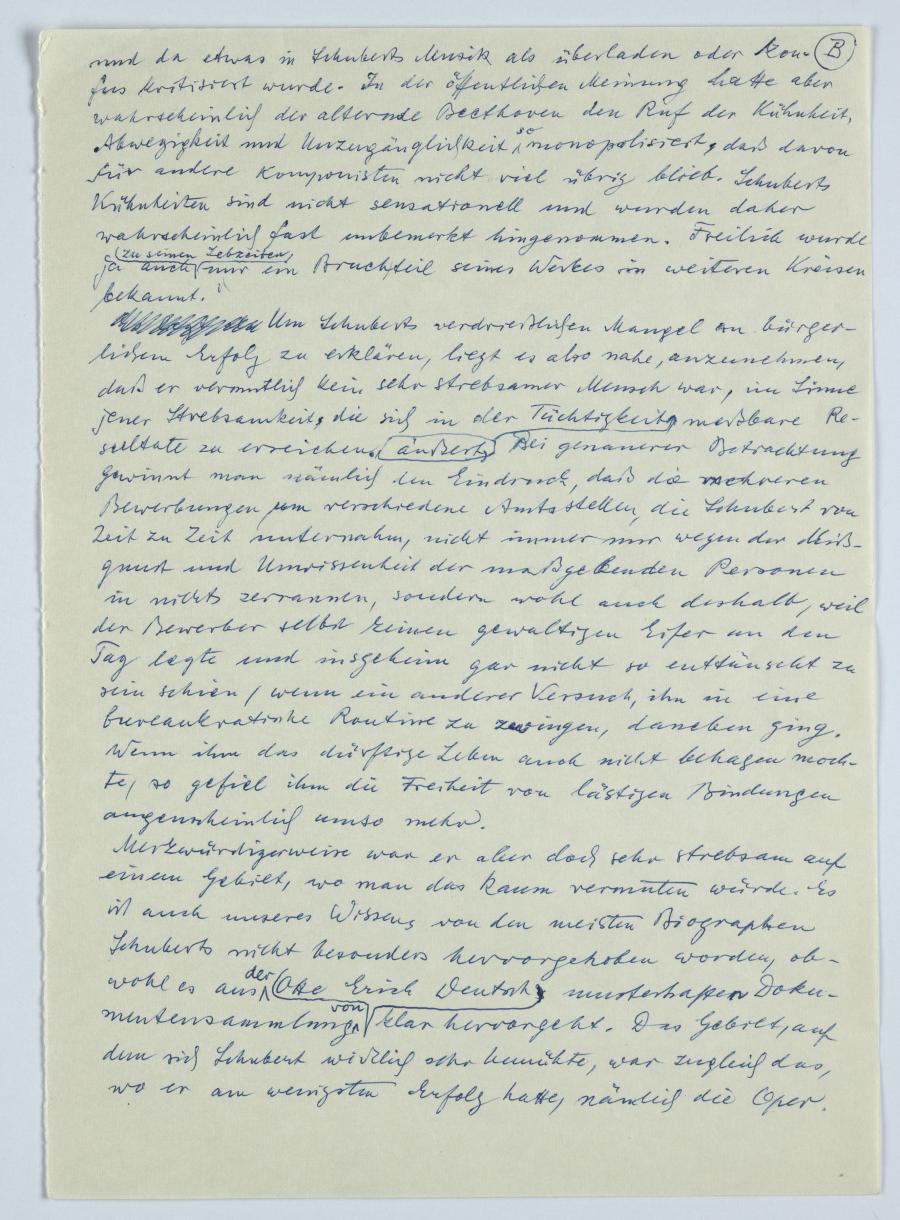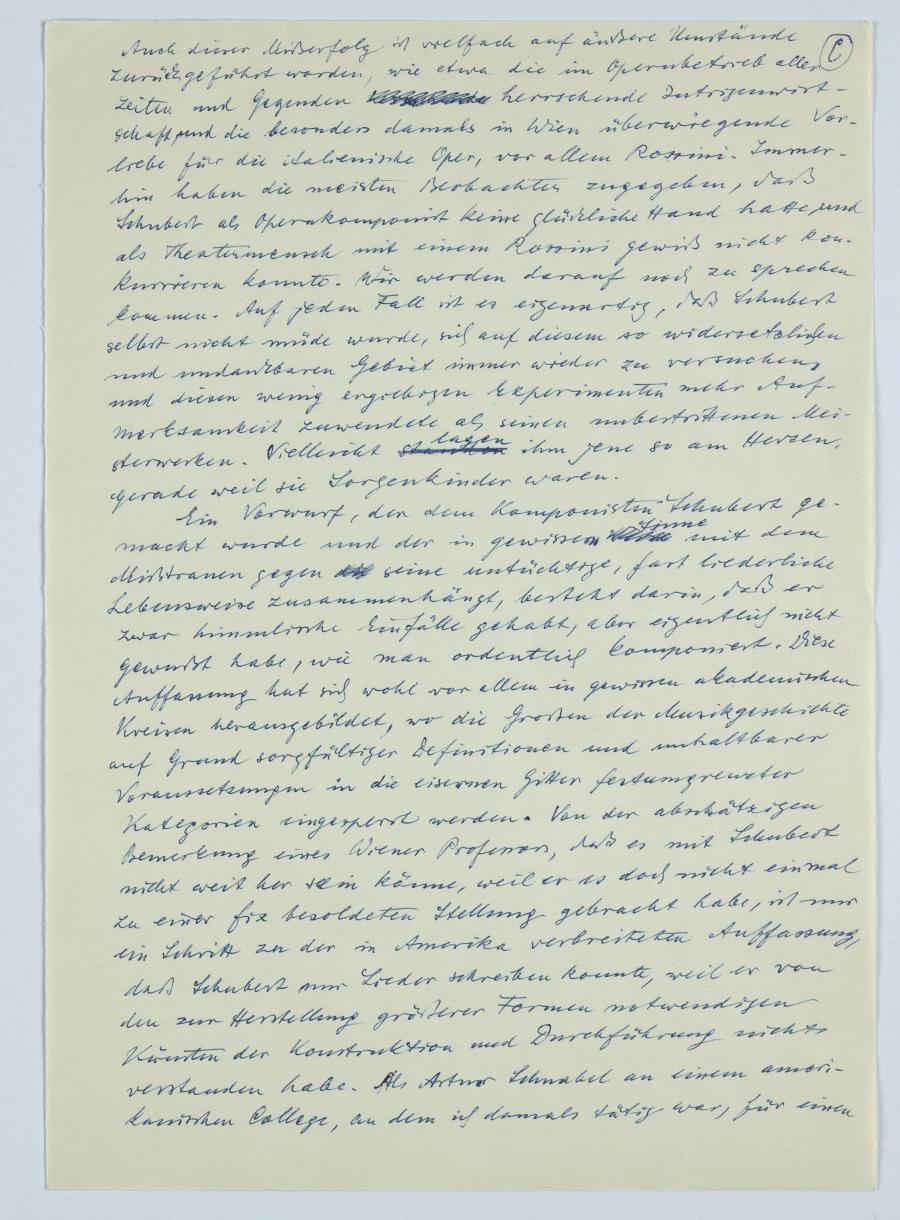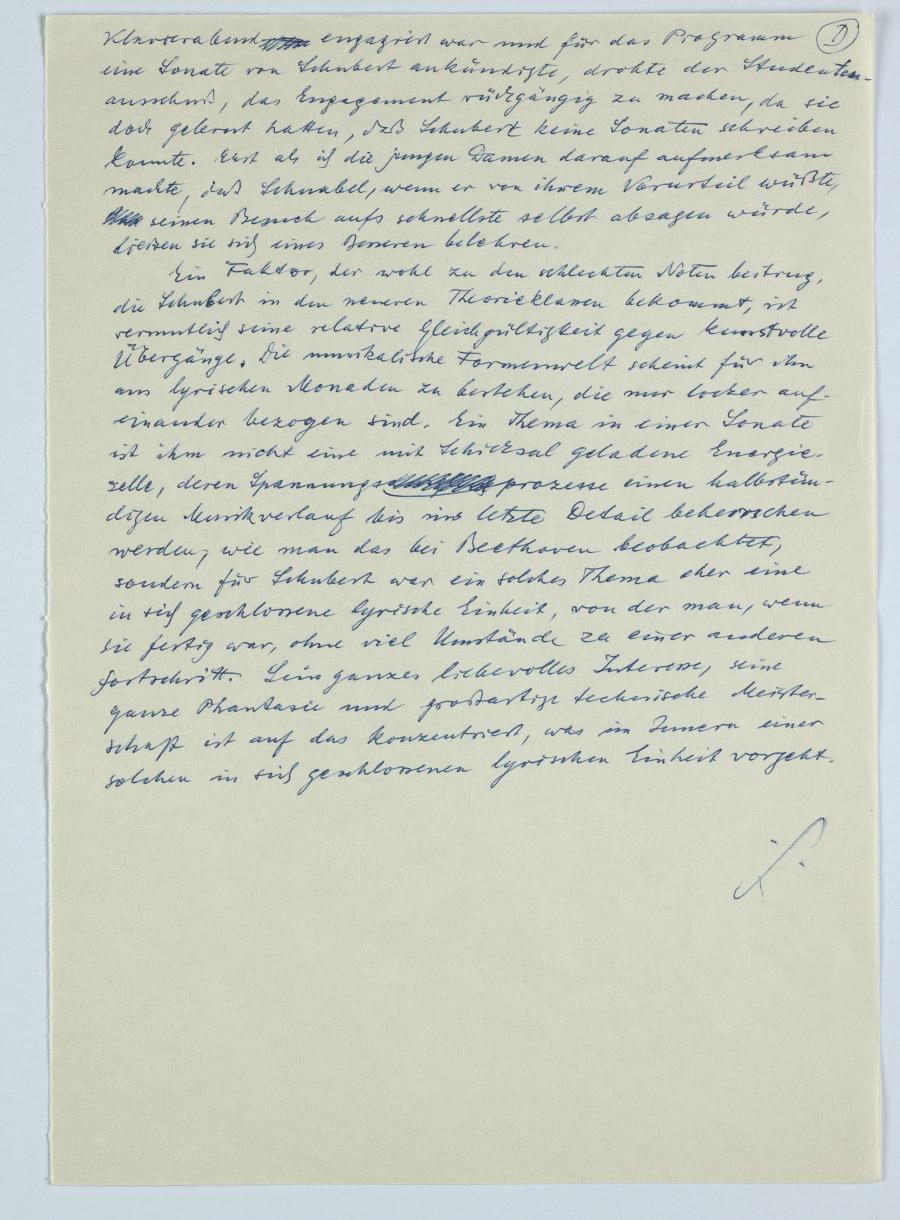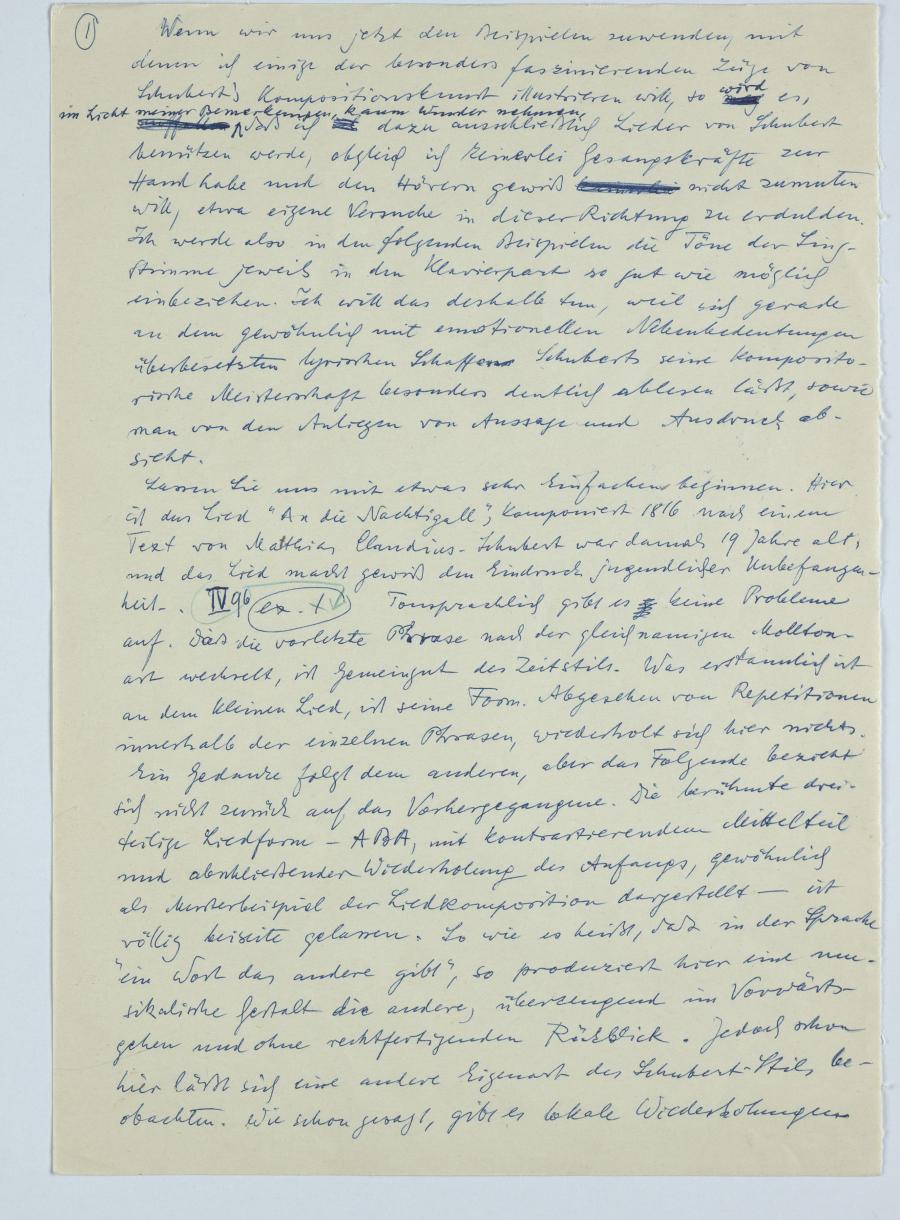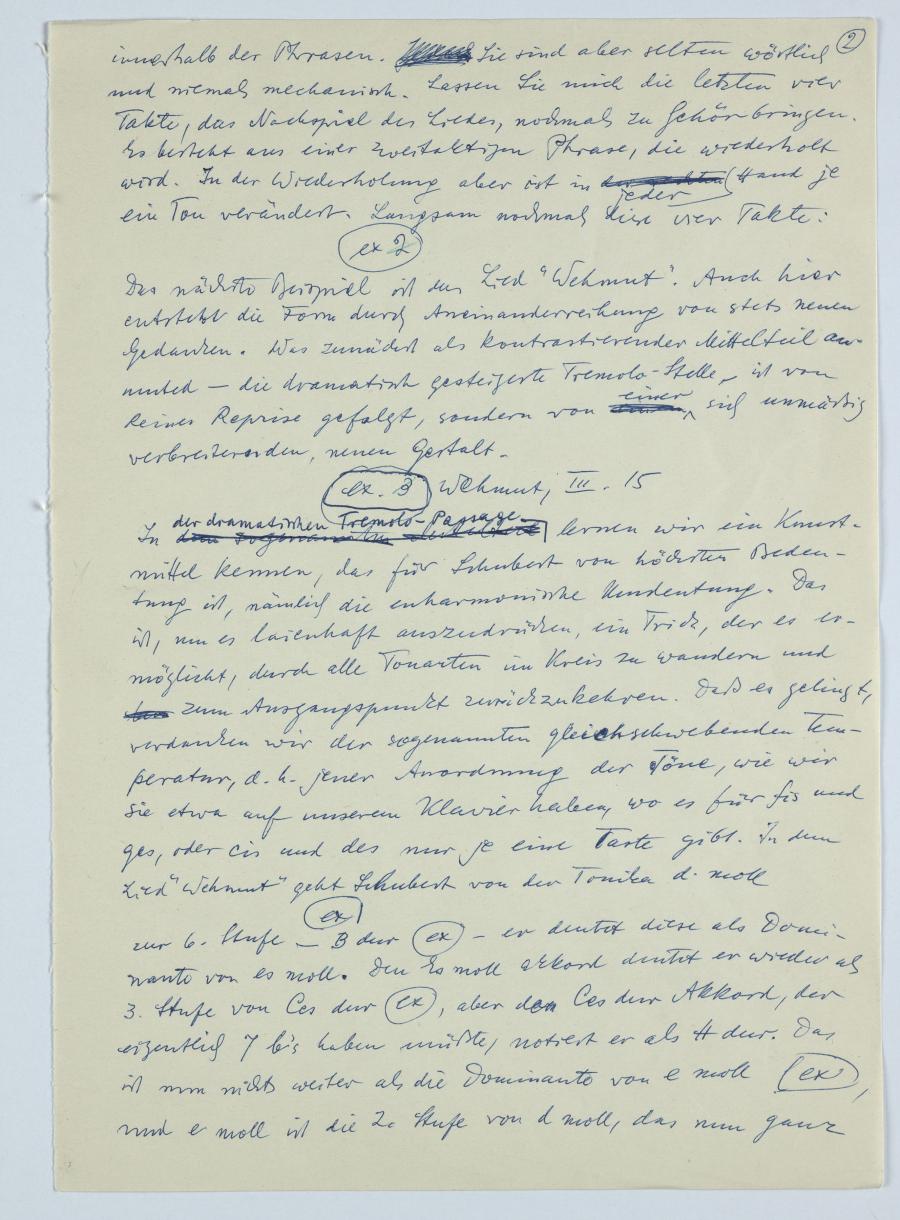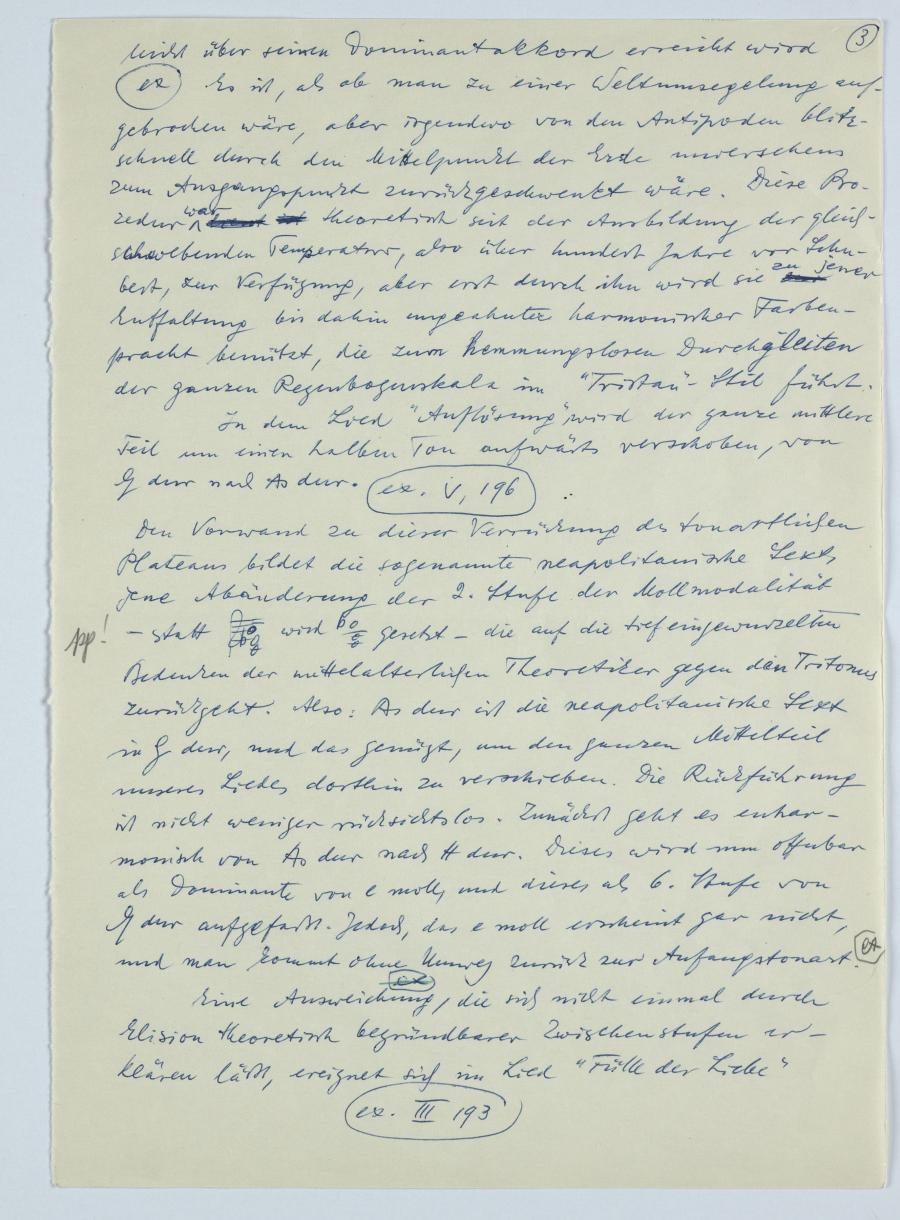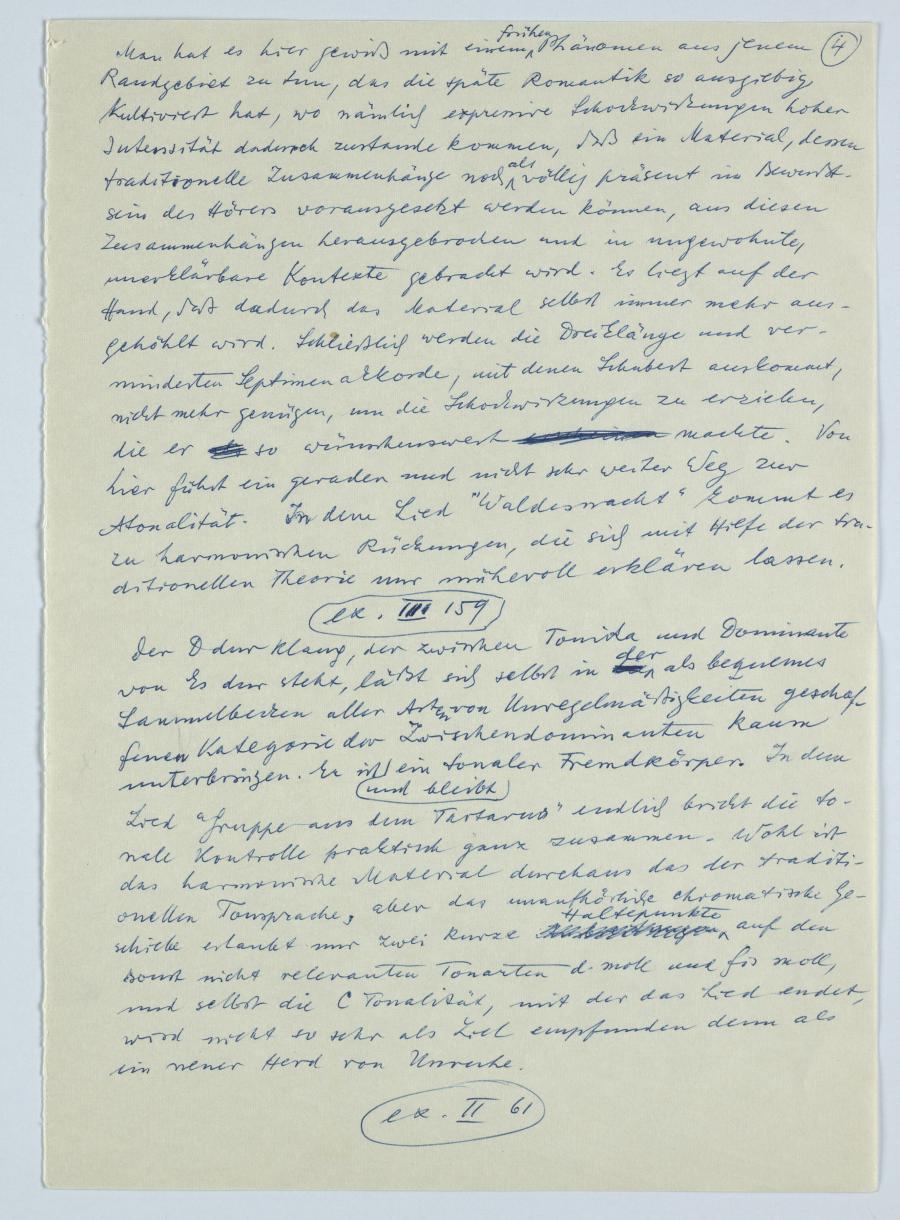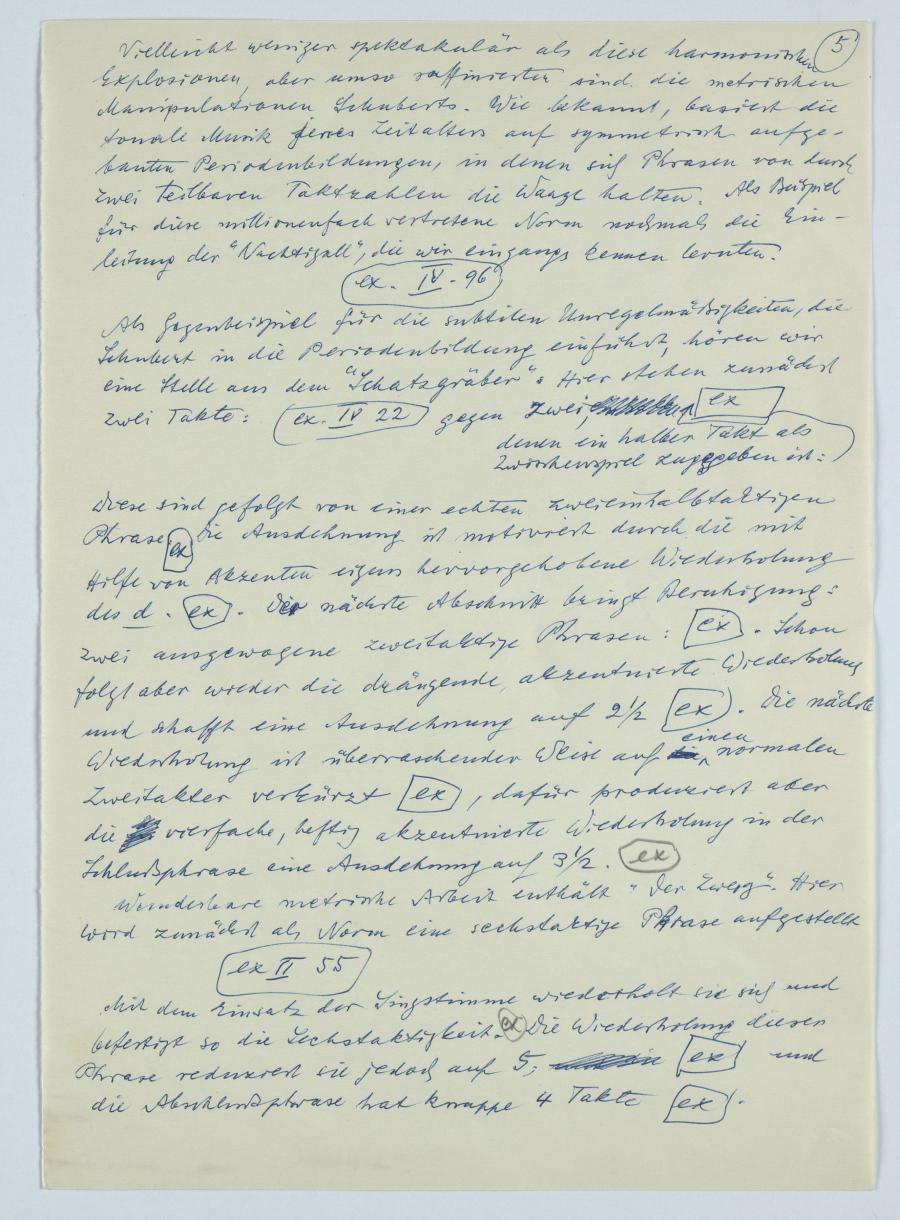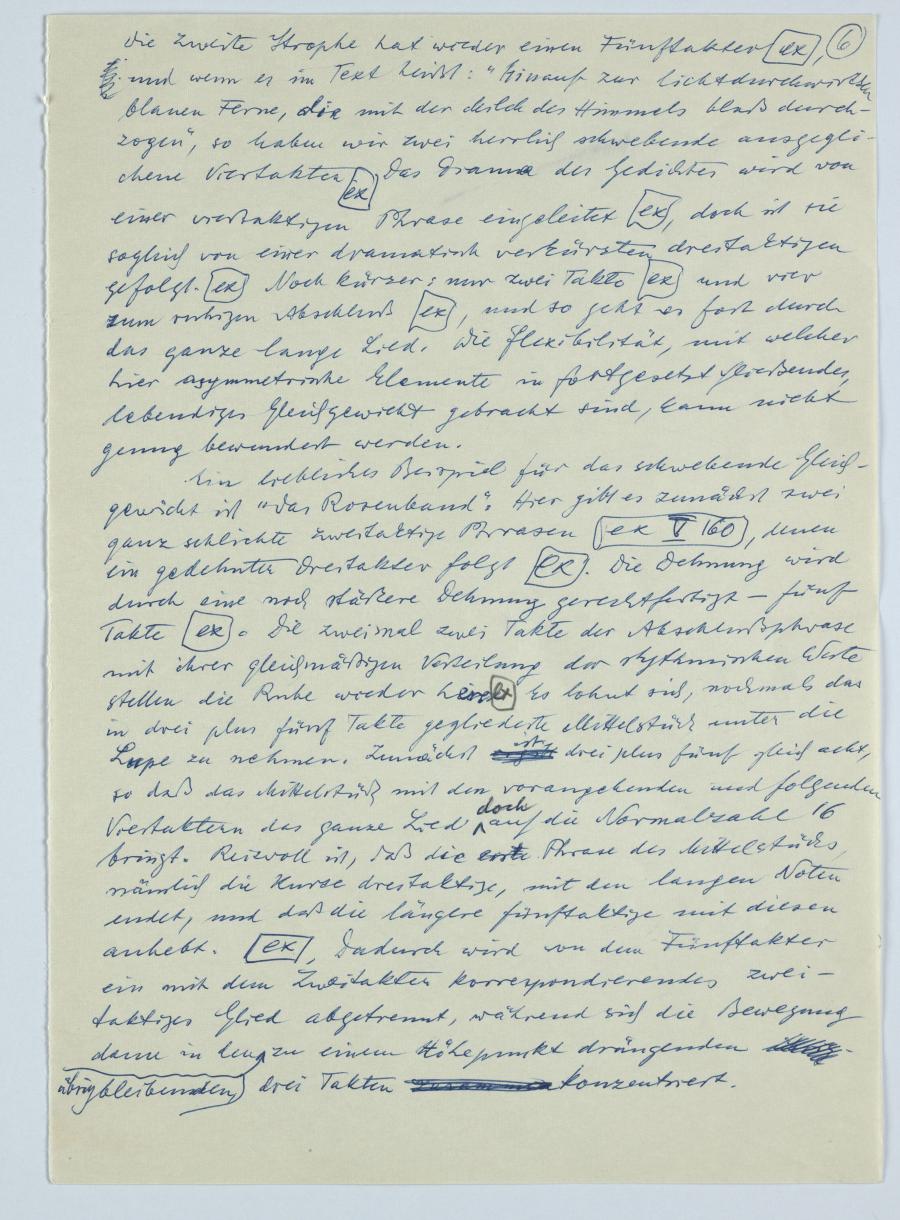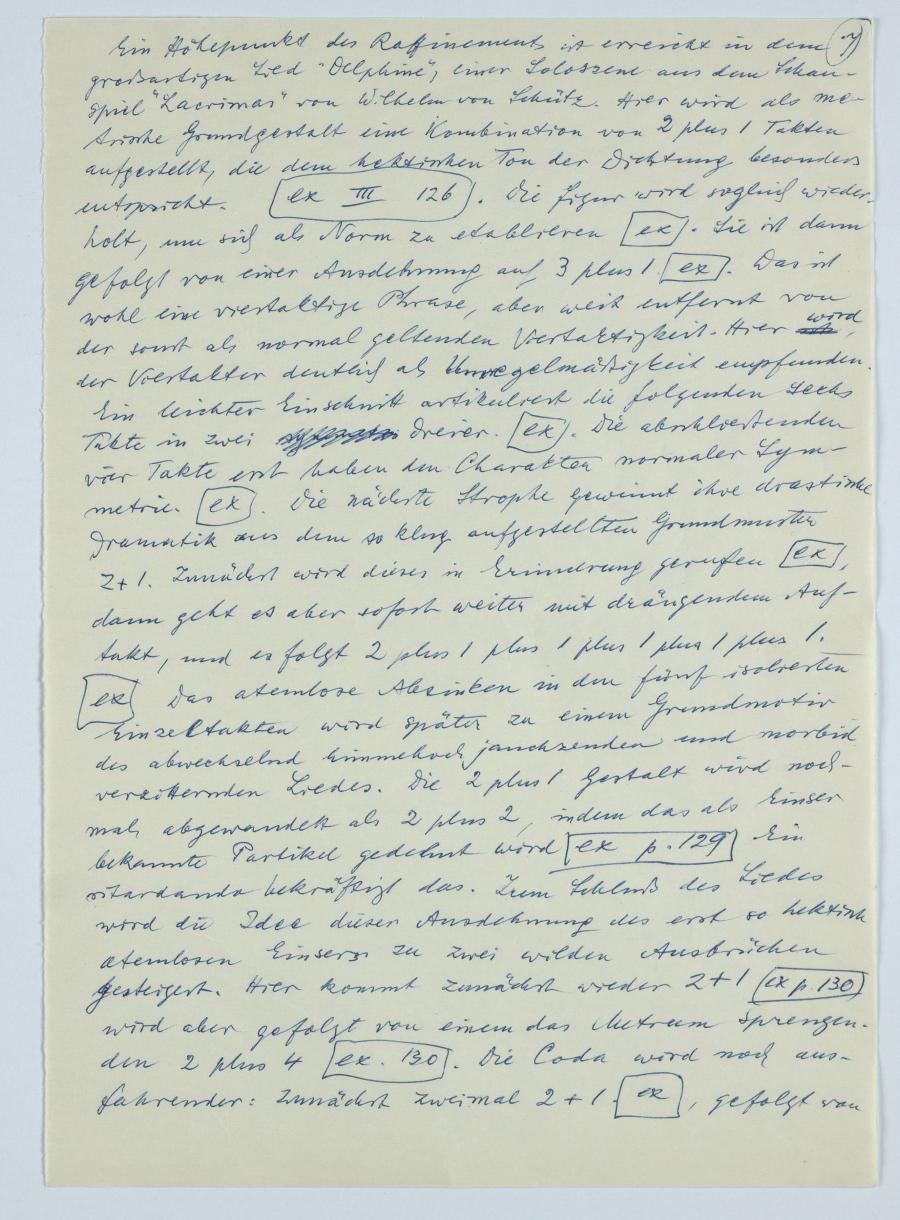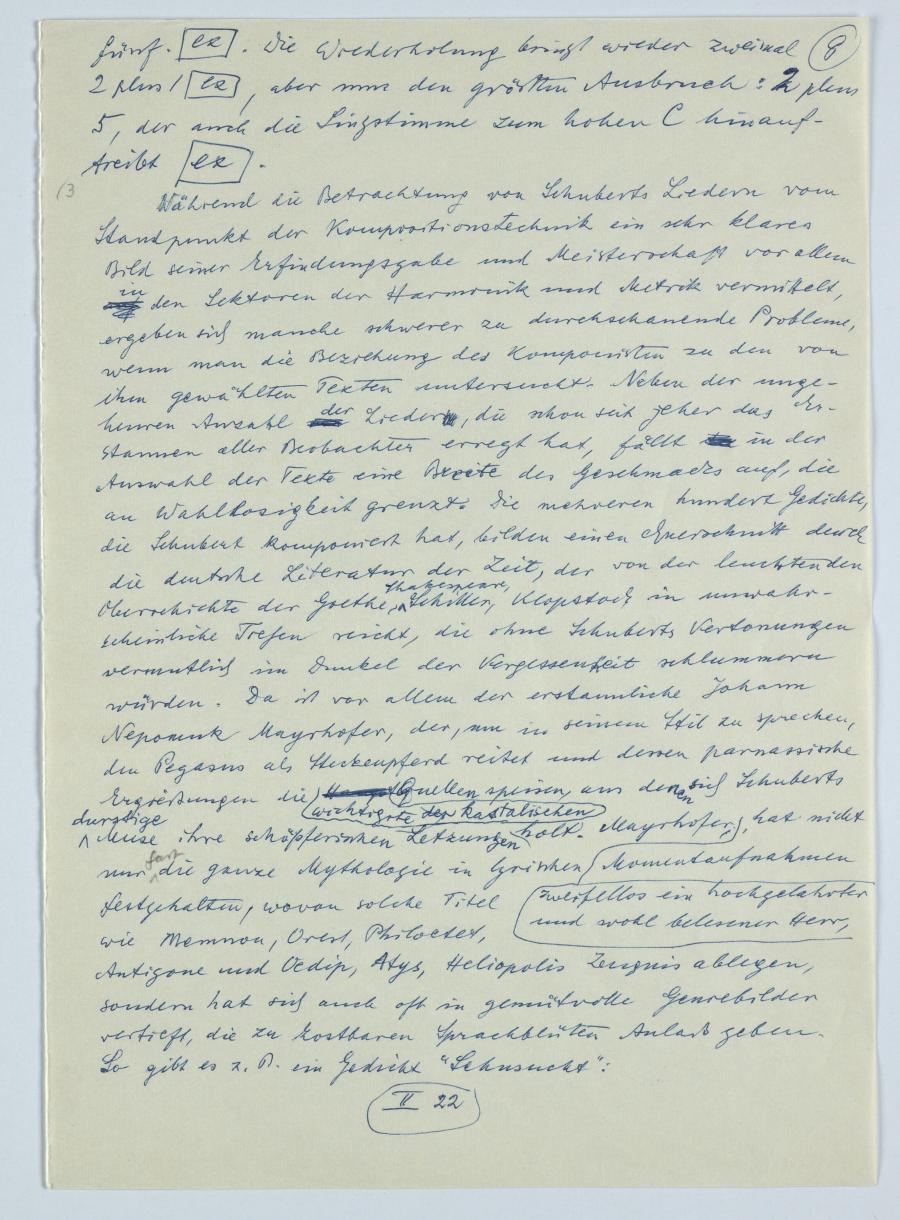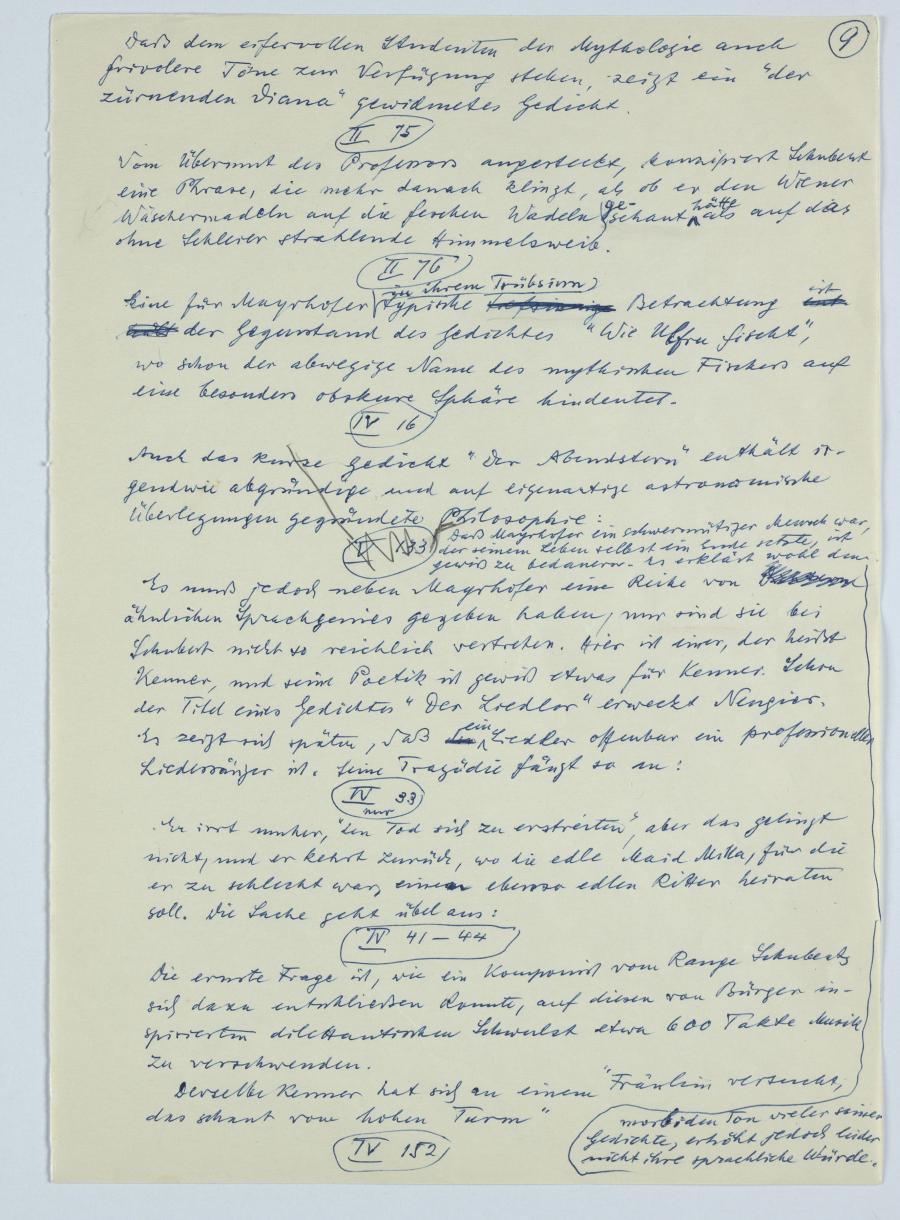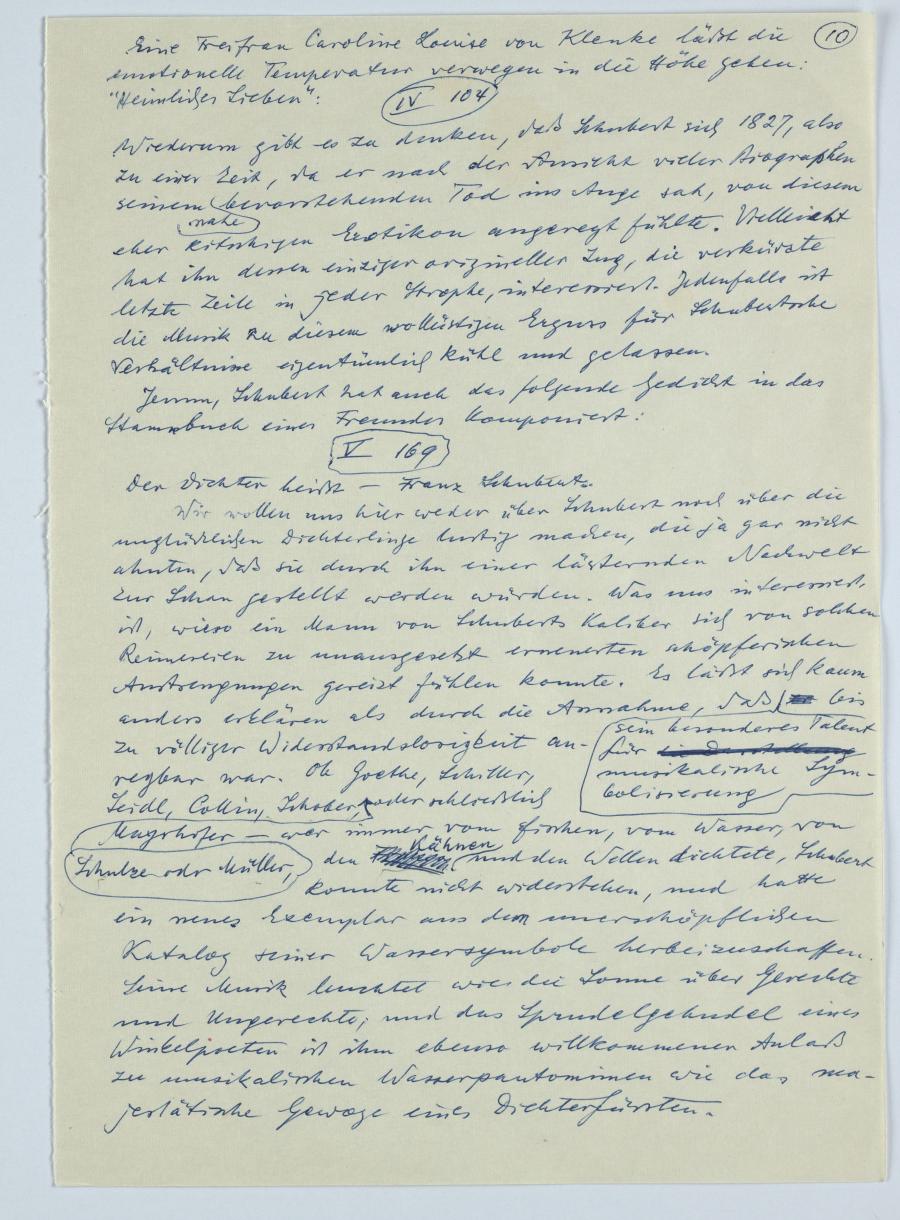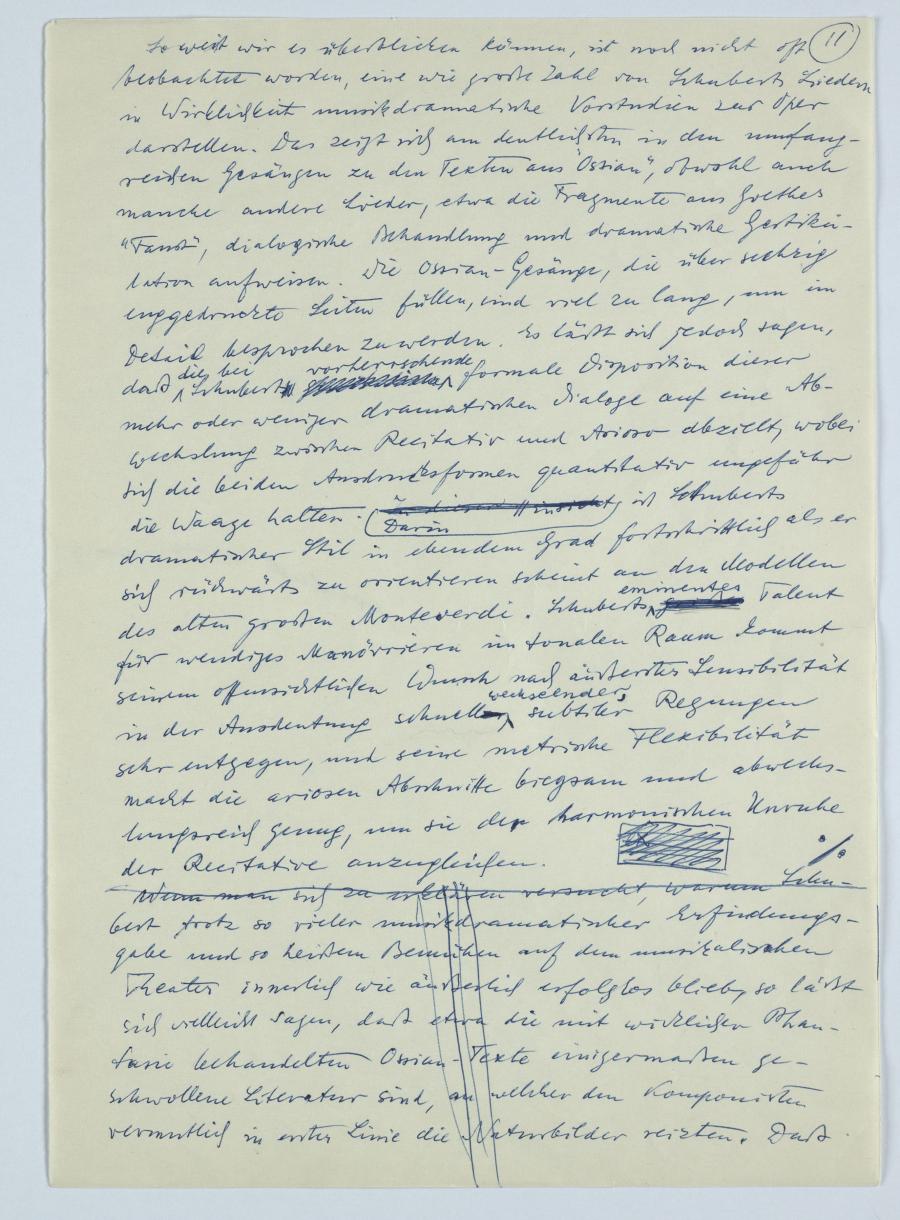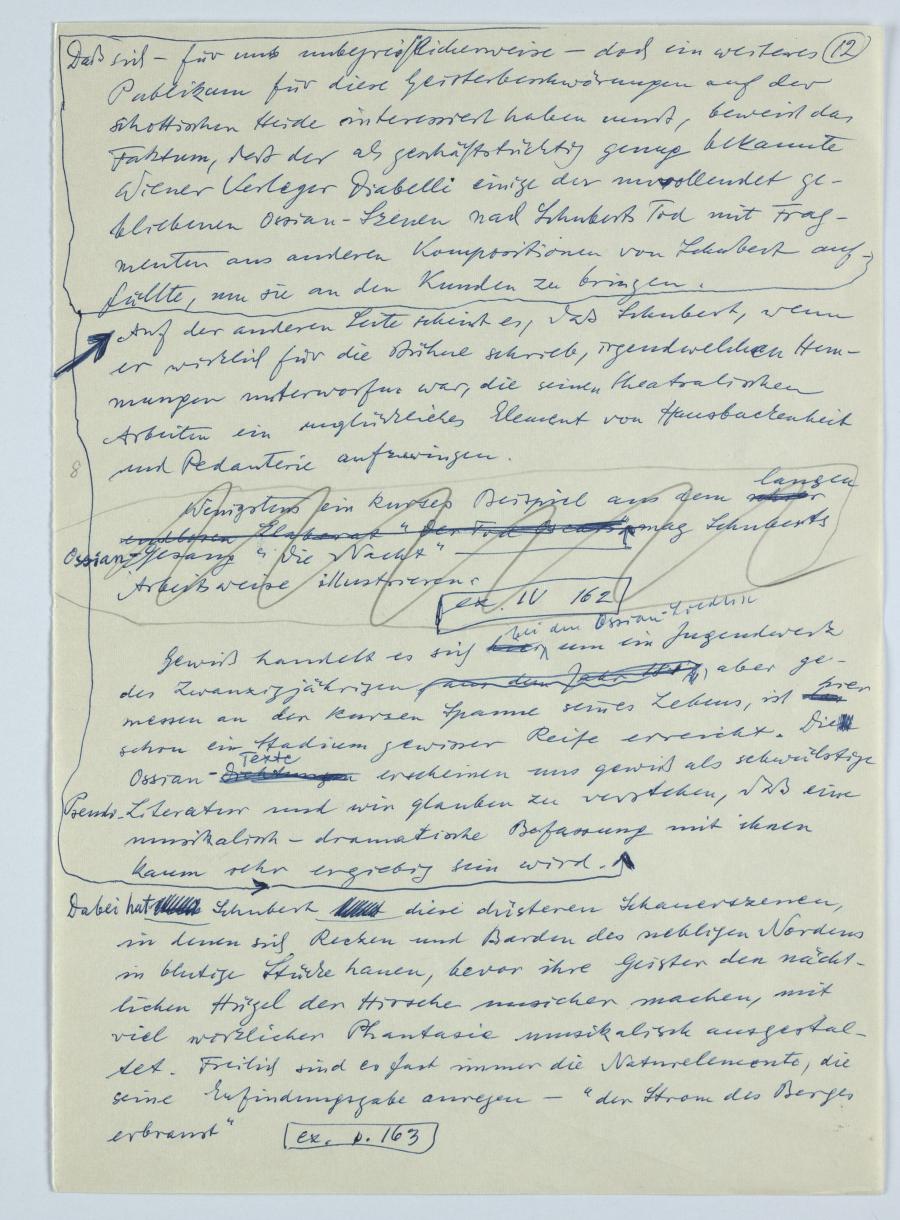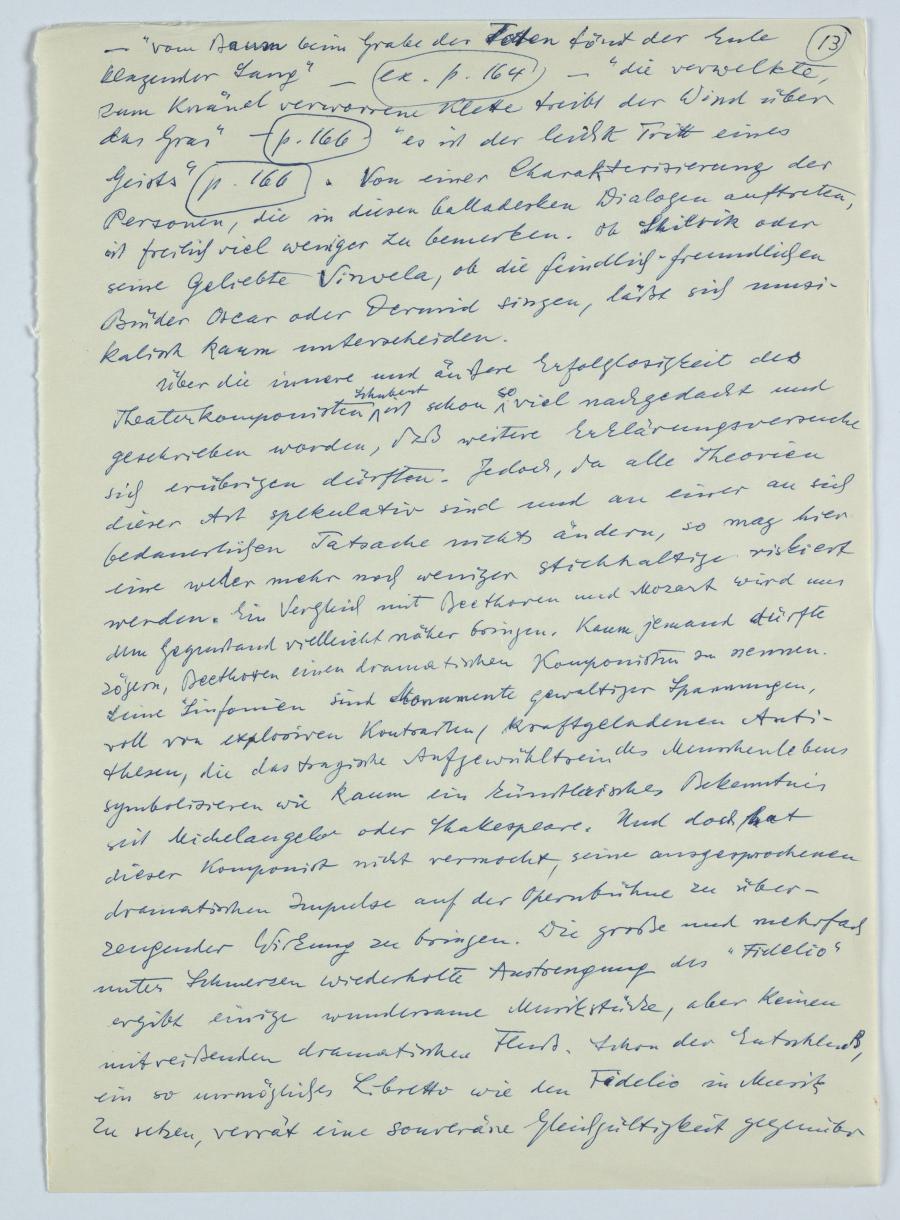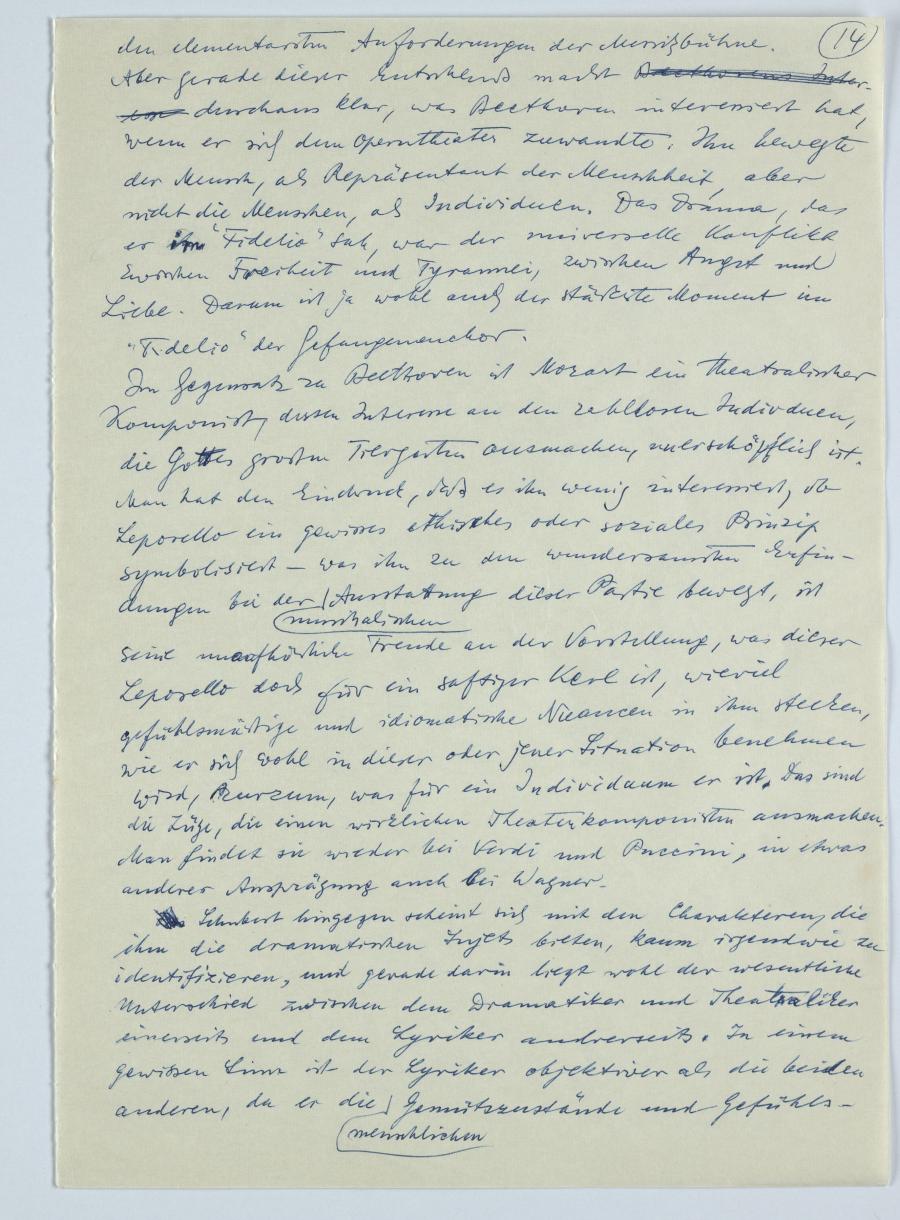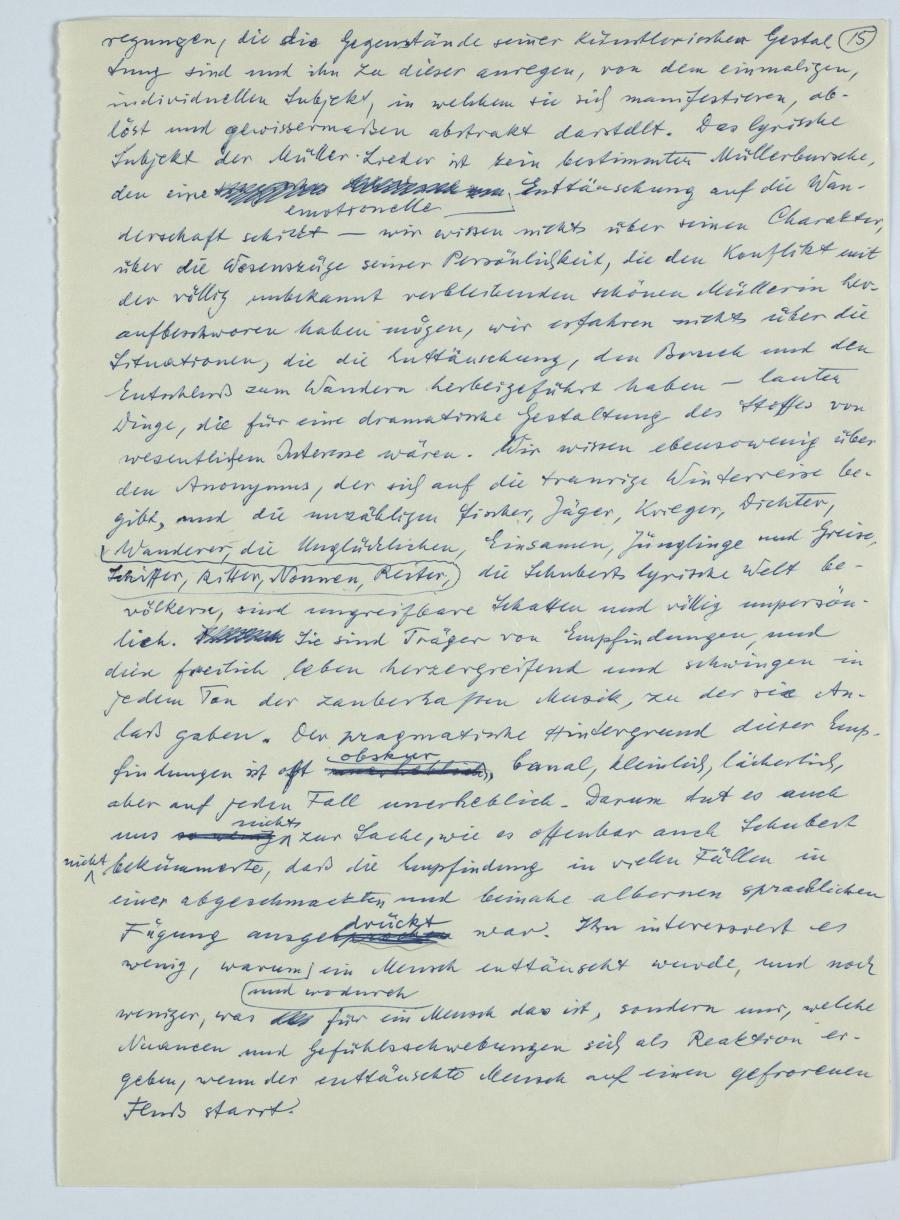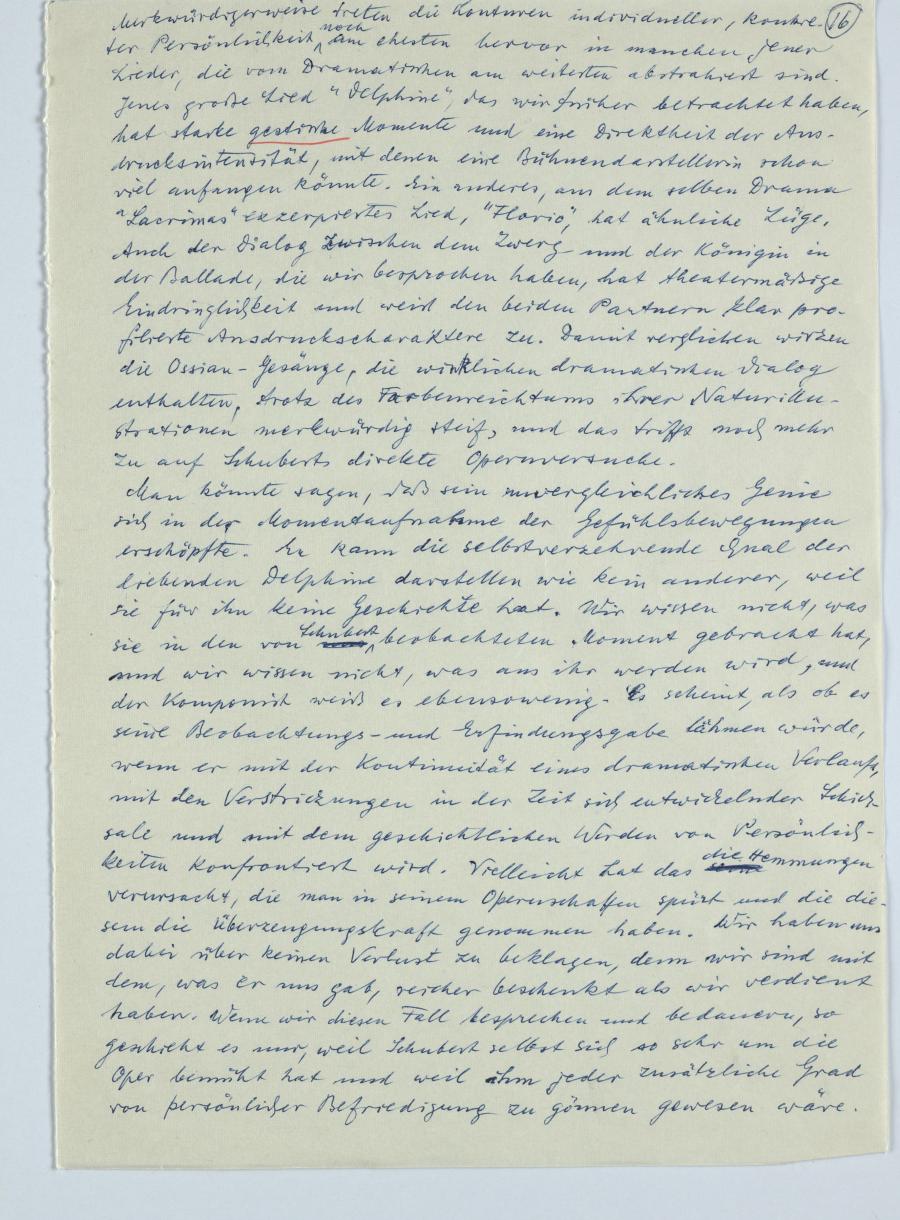A
Schubert
f. SWF
Baden-Baden
Es scheint, daß die Schubert-Biographen des 19. Jahrhun-
derts einige Schwierigkeiten hatten, ein überzeugendes
Charakterbild des Komponisten zu entwerfen. Auf
der einen Seite schien war es gewiß wünschenswert, einen so liebens-
würdig-gemütlichen Komponisten, dessen Porträtbüste
ebenso zum bürgerlichen Hausrat gehörte wie seine
bekannteren Musikstücke, als einen soliden, ehrsamen,
fleißigen, gutgearteten und wohlgesitteten Mitbürger
darzustellen, den jeder gern in seinem Haus empfangen
hätte. Daß er den Mädchen gegenüber so scheu war, machte
ihn nur noch sympathischer, da man ihn nun auch noch
ein wenig bedauern durfte, weil er, obgleich ein so großes
Genie, sich doch aus lauter Anständigkeit keine reguläre
Häuslichkeit zu verschaffen wußte. Demgegenüber stand
aber die auffallende und verdrießliche Tatsache, daß
ein so vorzüglicher Biedermann es im bürgerlichen Leben
zu nichts brachte gebracht hatte und als ein Habenichts dahinstarb.
Auch ließ es sich schwer verheimlichen, daß er sich viel
in Wirtshäusern herumgetrieben haben muß, wenn
man auf so drollige Details seiner Biographie, wie
daß er musikalische Genieblitze auf die Rückseite von Speise-
karten zu notieren pflegte, nicht verzichten wollte.
Sein Mangel an weltlichem Erfolg konnte auch nicht
damit begründet werden, daß er als verkanntes Genie
gegen den Widerstand einer verständnislosen und
feindseligen Mitwelt nicht aufkommen konnte.
Schuberts Musik wurde von seinen Zeitgenossen nicht
nie als radikal, aggressiv oder skandalös empfunden,
ja nicht einmal als besonders sensationell, obwohl
sie selbst für uns noch evident genug ist. Man
hört wohl, daß jemand über die Dissonanzen im
"Erlkönig" den Kopf geschüttelt habe, oder daß hie
ihre gelegentliche Kühnheit
B
und da etwas in Schuberts Musik als überladen oder kon-
fus kritisiert wurde. In der öffentlichen Meinung hatte aber
wahrscheinlich der alternde Beethoven den Ruf der Kühnheit,
Abwegigkeit und Unzugänglichkeit so monopolisiert, daß davon
für andere Komponisten nicht viel übrig blieb. Schuberts
Kühnheiten sind nicht sensationell und wurden daher
wahrscheinlich fast unbemerkt hingenommen. Freilich wurde
ja auch zu seinen Lebzeiten nur ein Bruchteil seines Werkes in weiteren Kreisen
bekannt.
Es liegt als Um Schuberts verdrießlichen Mangel an bürger-
lichem Erfolg zu erklären, liegt es also nahe, anzunehmen,
daß er vermutlich kein sehr strebsamer Mensch war, im Sinne
jener Strebsamkeit, die sich in der Tüchtigkeit äußert, meßbare Re-
sultate zu erreichen. Bei genauerer Betrachtung
gewinnt man nämlich den Eindruck, daß die mehreren
Bewerbungen um verschiedene Amtsstellen, die Schubert von
Zeit zu Zeit unternahm, nicht immer nur wegen der Miß-
gunst und Unwissenheit der maßgebenden Personen
in nichts zerrannen, sondern wohl auch deshalb, weil
der Bewerber selbst keinen gewaltigen Eifer an den
Tag legte und insgeheim gar nicht so enttäunscht zu
sein schien, wenn ein anderer Versuch, ihn in eine
bureaukratische Routine zu zwingen, daneben ging.
Wenn ihm das dürftige Leben auch nicht behagen moch-
te, so gefiel ihm die Freiheit von lästigen Bindungen
augenscheinlich umso mehr.
Merkwürdigerweise war er aber doch sehr strebsam auf
einem Gebiet, wo man das kaum vermuten würde. Es
ist auch unseres Wissens von den meisten Biographen
Schuberts nicht besonders hervorgehoben worden, ob-
wohl es aus der musterhaften Doku-
mentensammlung von Otto Erich Deutsch klar hervorgeht. Das Gebiet, auf
dem sich Schubert wirklich sehr bemühte, war zugleich das,
wo er am wenigsten Erfolg hatte, nämlich die Oper.
C
Auch dieser Mißerfolg ist vielfach auf äußere Umstände
zurückgeführt worden, wie etwa die im Opernbetrieb aller
Zeiten und Gegenden herrschende herrschende Intrigenwirt-
schaft und die besonders damals in Wien überwiegende Vor-
liebe für die italienische Oper, vor allem Rossini. Immer-
hin haben die meisten Beobachter zugegeben, daß
Schubert als Opernkomponist keine glückliche Hand hatte und
als Theatermensch mit einem Rossini gewiß nicht kon-
kurrieren konnte. Wir werden darauf noch zu sprechen
kommen. Auf jeden Fall ist es eigenartig, daß Schubert
selbst nicht müde wurde, sich auf diesem so widersetzlichen
und undankbaren Gebiet immer wieder zu versuchen,
und diesen wenig ergiebigen Experimenten mehr Auf-
merksamkeit zuwendete als seinen unbestrittenen Mei-
sterwerken. Vielleicht standen lagen ihm jene so am Herzen,
gerade weil sie Sorgenkinder waren.
Ein Vorwurf, der dem Komponisten Schubert ge-
macht wurde und der in gewissem Weise Sinne mit dem
Mißtrauen gegen die seine untüchtige, fast liederliche
Lebensweise zusammenhängt, besteht darin, daß er
zwar himmlische Einfälle gehabt, aber eigentlich nicht
gewußt habe, wie man ordentlich komponiert. Diese
Auffassung hat sich wohl vor allem in gewissen akademischen
Kreisen herausgebildet, wo die Großen der Musikgeschichte
auf Grund sorgfältiger Definitionen und unhaltbarer
Voraussetzungen in die eisernen Gitter festumgrenzter
Kategorien eingesperrt werden. Von der abschätzigen
Bemerkung eines Wiener Professors, daß es mit Schubert
nicht weit her sein könne, weil er es doch nicht einmal
zu einer fix besoldeten Stellung gebracht habe, ist nur
ein Schritt zu der in Amerika verbreiteten Auffassung,
daß Schubert nur Lieder schreiben konnte, weil er von
den zur Herstellung größerer Formen notwendigen
Künsten der Konstruktion und Durchführung nichts
verstanden habe. Als Artur Schnabel an einem ameri-
kanischen College, an dem ich damals tätig war, für einen
D
Klavierabend das seinen Besuch aufs schnellste selbst absagen würde,
ließen sie sich eines Besseren belehren.
Ein Faktor, der wohl zu den schlechten Noten beitrug,
die Schubert in den neueren Theorieklassen bekommt, ist
vermutlich seine relative Gleichgültigkeit gegen kunstvolle
Übergänge. Die musikalische Formenwelt scheint für ihn
aus lyrischen Monaden zu bestehen, die nur locker auf-
einander bezogen sind. Ein Thema in einer Sonate
ist ihm nicht eine mit Schicksal geladene Energie-
zelle, deren Spannungsausgleichprozesse einen halbstün
digen Musikverlauf bis ins letzte Detail beherrschen
werden, wie man das bei Beethoven beobachtet,
sondern für Schubert war ein solches Thema eher eine
in sich geschlossene lyrische Einheit, von der man, wenn
sie fertig war, ohne viel Umstände zu einer anderen
fortschritt. Sein ganzes liebevolles Interesse, seine
ganze Phantasie und großartige technische Meister-
schaft ist auf das konzentriert, was im Innnern einer
solchen in sich geschlossenen lyrischen Einheit vorgeht.
1
Wenn wir uns jetzt den Beispielen zuwenden, mit
denen ich einige der besonders faszinierenden Züge von
Schuberts Kompositionskunst illustrieren will, so mag wird es,
aufallen im Licht meiner Bemerkungen, kaum Wunder nehmen, daß ich
Lassen Sie uns mit etwas sehr Einfachen beginnen. Hier
ist das Lied "An die Nachtigall", komponiert 1816 nach einem
Text von Matthias Claudius. Schubert war damals 19 Jahre alt
und das Lied macht gewiß den Eindruck jugendlicher Unbefangen-
heit. ex. 1 IV 96 Tonsprachlich gibt es keine Probleme
auf. Daß die vorletzte Phrase nach der gleichnamigen Mollton-
art wechselt, ist gemeingut des Zeitstils. Was erstaunlich ist
an dem kleinen Lied, ist seine Form. Abgesehen von Repetitionen
innerhalb der einzelnen Phrasen, wiederholt sich hier nichts.
Ein Gedanke folgt dem anderen, aber das Folgende bezieht
sich nicht zurück auf das Vorhergegangene. Die berühmte drei-
teilige Liedform - ABA, mit kontrastierendem Mittelteil
und abschließender Wiederholung des Anfangs, gewöhnlich
als Musterbeispiel der Liedkomposition dargestellt - ist
völlig beiseite gelassen. So wie es heißt, daß in der Sprache
"ein Wort das andere gibt", so produziert hier eine mu-
sikalische Gestalt die andere, überzeugend im Vorwärts-
gehen und ohne rechtfertigenden Rückblick. Jedoch schon
hier läßt sich eine andere Eigenart des Schubert-Stils be-
obachten. Wie schon gesagt, gibt es lokale Wiederholungen
2
innerhalb der Phrasen. Jedes Sie sind aber selten wörtlich
und niemals mechanisch. Lassen Sie mich die letzten vier
Takte, das Nachspiel des Liedes, nochmals zu Gehör bringen.
Es besteht aus einer zweitaktigen Phrase, die wiederholt
wird. In der Wiederholung aber ist in der rechten jeder Hand je
ein Ton verändert. Langsam nochmal diese vier Takte.
ex 2
Das nächste Beispiel ist das Lied "Wehmut". Auch hier
entsteht die Form durch Aneinanderreihung von stets neuen
Gedanken. Was zunächst als kontrastierender Mittelteil an-
muted - die dramatisch gesteigerte Tremolo-Stelle, ist von
keiner Reprise gefolgt, sondern von dieser einer sich unmäßig
verbreiternden neuen Gestalt.
ex. 3 Wehmut, III. 15
In dem sogenannten Mittelteil der dramatischen Tremolo-Passage lernen wir ein Kunst-
mittel kennen, das für Schubert von höchsten Bedeu-
tung ist, nämlich die enharmonische Umdeutung. Das
ist, um es laienhaft auszudrücken, ein Trick, der es er-
möglicht, durch alle Tonarten im Kreis zu wandern und
dem zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Daß es gelingt,
verdanken wir der sogenannten gleichschwebenden Tem-
peratur, d. h. jener Anordnung der Töne, wie wir
sie etwa auf unserem Klavier haben, wo es für fis und
ges, oder cis und des nur je eine Taste gibt. In dem
Lied "Wehmut" geht Schubert von der Tonika d-moll
ex
zur 6. Stufe — B dur ex — er deutet diese als Domi-
mante von es moll. Den Es moll Akkord deutet er wieder als
3. Stufe von Ces dur ex, aber den Ces dur Akkord, der
eigentlich 7 b´s haben müßte, notiert er als H dur. Das
ist nun nichts weiter als die Dominante von e moll ex
und e moll ist die 2. Stufe von d moll, das nun ganz
3
leicht über seinen Dominantakkord erreicht wird
ex Es ist, als ob man zu einer Weltumsegelung auf-
gebrochen wäre, aber irgendwo von den Antipoden blitz-
schnell durch den Mittelpunkt der Erde unversehens
zum Ausgangspunkt zurückgeschwenkt wäre. Diese Pro-
zedur war ex. V, 196
Den Vorwand zu dieser Verrückung des tonartlichen
Plateaus bildet die sogenannte neapolitanische Sext,
jene Abänderung der 2. Stufe der Mollmodalität
- statt wird gesetzt - die auf die tief eingewurzelten
Bedenken der mittelalterlichen Theoretiker gegen den Tritonus
zurückgeht. Also: As dur ist die neapolitanische Sext
in G dur, und das genügt, um den ganzen Mittelteil
unseres Liedes dorthin zu verschieben. Die Rückführung
ist nicht weniger rücksichtslos. Zunächst geht es enhar-
monisch von As dur nach H dur. Dieses wird nun offenbar
als Dominante von e moll, und dieses als 6. Stufe von
G dur aufgefaßt. Jedoch, das e moll erscheint gar nicht,
und man kommt ohne Umweg zurück zur Anfangstonart.
exex
Eine Ausweichung, die sich nicht einmal durch
Elision theoretisch begründbarer Zwischenstufen er-
klären läßt, ereignet sich im Lied "Fülle der Liebe"
ex. III 193
4
Man hat es hier gewiß mit einem frühen Phänomen aus jenem
Randgebiet zu tun, das die späte Romantik so ausgiebig
kultiviert hat, wo nämlich expressive Schockwirkungen hoher
Intensität dadurch zustande kommen, daß ein Material, dessen
traditionelle Zusammenhänge noch als völlig präsent im Bewußt-
sein des Hörens vorausgesetzt werden können, aus diesen
Zusammenhängen herausgebrochen und in ungewohnte,
unerklärbare Kontexte gebracht wird. Es liegt auf der
Hand, daß dadurch das Material selbst immer mehr aus-
gehöhlt wird. Schließlich werden die Dreiklänge und ver-
minderten Septimenakkorde, mit denen Schubert auskommt,
nicht mehr genügen, um die Schockwirkungen zu erzielen,
die er als so wünschenswert erscheinen machte. Von
hier führt ein gerader und nicht sehr weiter Weg zur
Atonalität. In dem Lied "Waldesnacht" kommt es
zu harmonischen Rückungen, die sich mit Hilfe der tra-
ditionellen Theorie nur mühevoll erklären lassen.
ex. III 159
Der D dur Klang, der zwischen Tonika und Dominante
von Es dur steht, läßt sich selbst in die der als bequemes
Sammelbecken aller Arten von Unregelmäßigkeiten geschaf-
fenen Kategorie der Zwischendominanten kaum
unterbringen. Er ist und bleibt ein tonaler Fremdkörper. In dem
Lied "Gruppe aus dem Tartarus" endlich bricht die to-
nale Kontrolle praktisch ganz zusammen. Wohl ist
das harmonische Material durchaus das der traditi-
onellen Tonsprache, aber das unaufhörliche chromatische Ge-
schiebe erlaubt nur zwei kurze Ausbreitungen Haltepunkte auf den
sonst nicht relevanten Tonarten d-moll und fis moll,
und selbst die C Tonalität, mit der das Lied endet,
wird nicht so sehr als Ziel empfunden denn als
ein neuer Herd von Unruhe.
ex. II 61
5
Vielleicht weniger spektakulär als diese harmonischen
Explosionen, aber umso raffinierter sind die metrischen
Manipulationen Schuberts. Wie bekannt, basiert die
tonale Musik jenes Zeitalters auf symmetrisch aufge-
bauten Periodenbildungen, in denen sich Phrasen von durch
zwei teilbaren Taktzahlen die Waage halten. Als Beispiel
für diese millionenfach vertretene Norm nochmals die Ein-
leitung der "Nachtigall", die wir eingangs kennen lernten.
ex. IV - 96
Als Gegenbeispiel für die subtilen Unregelmäßigkeiten, die
Schubert in die Periodenbildung einführt, hören wir
eine Stelle aus dem "Schatzgräber". Hier stehen zunächst
zwei Takte: ex. IV 22 gegen zwei, einhalb ex
Diese sind gefolgt von einer echten zweieinhalbtaktigen
Phrase. ex Die Ausdehnung ist motiviert durch die mit
Hilfe von Akzenten eigens hervorgehobene Wiederholung
des d. ex. Der nächste Abschnitt bringt Beruhigung:
zwei ausgewogene zweitaktige Phrasen: ex. Schon
folgt aber wieder die drängende, akzentuierte Wiederholung
und schafft eine Ausdehnung auf 2 ½ ex. Die nächste
Wiederholung ist überraschender Weise auf die einen normalen
Zweitakter verkürzt ex, dafür produziert aber
die vierfache, heftig akzentuierte Wiederholung in der
Schlußphrase eine Ausdehnung auf 3 ½ . ex
Wunderbare metrische Arbeit enthält "Der Zwerg". Hier
wird zunächst als Norm eine sechstaktige Phrase aufgestellt
ex II 55
Mit dem Einsatz der Singstimme wiederholt sie sich und
befestigt so die Sechstaktigkeit. ex Die Wiederholung dieser
Phrase reduziert sie jedoch auf 5, und die ex und
die Abschlußphrase hat knappe 4 Takte ex.
denen ein halber Takt als
Zwischenspiel zugegeben ist:
6
Die zweite Strophe hat wieder einen Fünftakter ex,
und wenn es im Text heißt: "Hinauf zur lichtdurchwirkten
blauen Ferne, die mit der Milch des Himmels bloß durch-
zogen", so haben wir zwei herrlich schwebende ausgegli-
chene Viertakter ex. Das Drama des Gedichtes wird von
einer viertaktigen Phrase eingeleitet ex, doch ist sie
sogleich von einer dramatisch verkürzten dreitaktigen
gefolgt. ex Noch kürzer: nur zwei Takte ex und vier
zum ruhigen Abschluß ex, und so geht es fast durch
das ganze lange Lied. Die Flexibilität, mit welcher
hier asymmetrische Elemente in fortgesetzt fließendes,
lebendiges Gleichgewicht gebracht sind, kann nicht
genug bewundert werden.
Ein liebliches Beipiel für das schwebende Gleich-
gewicht ist, "Das Rosenband". Hier gibt es zunächst zwei
ganz schlichte zweitaktige Phrasen ex V 160, denen
ein gedehnter Dreitakter folgt ex. Die Dehnung wird
durch eine noch stärkere Dehnung gerechtfertigt — fünf
Takte ex. Die zweimal zwei Takte der Abschlußphrase
mit ihrer gleichmäßigen Verteilung der rhythmischen Werte
stellen die Ruhe wieder her. ex Es lohnt sich, nochmals das
in drei plus fünf Takte gegliederte Mittelstück unter die
Lupe zu nehmen. Zunächst ergibt ist drei plus fünf gleich acht,
so daß das Mittelstück mit den vorangehenden und folgenden
Viertaktern das ganze Lied doch auf die Normalzahl 16
bringt. Reizvoll ist, daß die erste Phrase des Mittelstückes
nämlich die kurze dreitaktige, mit den langen Noten
endet, und daß die längere fünftaktige mit diesen
anhebt. ex Dadurch wird von dem Fünftakter
ein mit dem Zweitakter korrespondierendes zwei-
taktiges Glied abgetrennt, während sich die Bewegung
dann in den zu einem Höhepunkt drängenden übrig
, drei Takten zusammen konzentriert.
übrigbleibenden,
7
Ein Höhepunkt des Raffinement ist erreicht in dem
großartigen Lied "Delphine", einer Soloszene aus dem Schau-
spiel "Lacrimas" von Wilhelm von Schütz. Hier wird als me-
trische Grundgestalt eine Kombination von 2 plus 1 Takten
aufgestellt, die dem hektischen Ton der Dichtung besonders
entspricht. ex II 126. Die Figur wird sogleich wieder-
holt, um sich als Norm zu etablieren ex. Sie ist dann
gefolgt von einer Ausdehnung auf 3 plus 1 ex. Das ist
wohl eine viertaktige Phrase, aber weit entfernt von
der sonst als normal geltenden Viertaktigkeit. Hier ist wird
der Viertakter deutlich als Unregelmäßigkeit empfunden.
Ein leichter Einschnitt artikuliert die folgenden Sechs
Takte in zwei symmetri Dreier. ex. Die abschließenden
vier Takte erst haben den Charakter normaler Sym-
metrie ex. Die nächste Strophe gewinnt ihre drastische
Dramatik aus dem so klug aufgestellten Grundmuster
2+1. Zunächst wird dieses in Erinnerung gerufen ex,
dann geht es aber sofort weiter mit drängendem Auf-
takt, und es folgt 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1.
ex Das atemlose Absinken in den fünf isolierten
Einzeltakten wird später zu einem Grundmotiv
des abwechselnd himmelhoch jauchzenden und morbid
verzitternden Liedes. Die 2 plus 1 Gestalt wird noch-
mals abgewandelt als 2 plus 2, indem das als Einser
bekannte Partikel gedehnt wird. ex p. 129 Ein
ritardando bekräftigt das. Zum Schluß des Liedes
wird die Idee dieser Ausdehnung des erst so hektisch
atemlosen Einsers zu zwei wilden Ausbrüchen
gesteigert. Hier kommt zunächst wieder 2+1 ex p. 130
wird aber gefolgt von einem das Metrum sprengen-
den 2 plus 4 ex. 130. Die Coda wird noch aus-
fahrender: zunächst zweimal 2 + 1. ex. gefolgt von
8
fünf. ex. Die Wiederholung bringt wieder zweimal
2 plus 1 ex, aber nun den größten Ausbruch: 2 plus
5, der auch die Singstimme zum hohen C hinauf-
treibt ex.
Während die Betrachtung von Schuberts Liedern vom
Standpunkt der Kompositionstechnik ein sehr klares
Bild seiner Erfindungsgabe und Meisterschaft vor allem
auf in den Sektoren der Harmonik und Metrik vermittelt,
ergeben sich manche schwerer zu durchschauende Probleme,
wenn man die Beziehung des Komponisten zu den von
ihm gewählten Texten untersucht. Neben der unge-
heuren Anzahl von der Liedern, die schon seit jeher das Er-
staunen aller Beobachter erregt hat, fällt Haupt wichstigste der kastalischen Quellen speisen, aus denen sich Schuberts
durstige Muse ihre, schöpferischen Letzungen holt. Mayrhofer hat nicht
nur fast die ganze Mythologie in lyrischen Momentaufnahmen
festgehalten, wovon solche Titel
wie Mamnon, Orest, Philoetet,
Antigone und Oedip, Atys, Heliopolis Zeugnis ablegen,
sondern hat sich auch oft in gemütvolle Genrebilder
vertieft, die zu kostbaren Sprachblüten Anlaß geben.
So gibt es z. B. ein Gedicht "Sehnsucht":
II 22
/3
zweifellos ein hochgelehrter
und wohl belesener Herr,
9
Daß dem eifervollen Studenten der Mythologie auch
frivolere Töne zur Verfügung stehen, zeigt ein "der
zürnenden Diana" gewidmetes Gedicht.
II 75
Vom Übermut des Profssors angesteckt, konzipiert Schubert
eine Phrase, die mehr danach klingt, als ob er den Wiener
Wäschermadeln auf die feschen Wadeln ge-schaut hätte als auf das
ohne Schleier strahlende Himmelsweib.
II 76
Eine für Mayrhofer in ihren Trübsinn typische tiefsinnige Betrachtung ent ist
hält der Gegenstand des Gedichtes "Wie Ulfru fischt",
wo schon der abwegige Name des mythischen Fischers auf
eine besonders obskure Sphäre hindeutet.
IV 16
Auch das kurze Gedicht" Der Abendstern" enthält ir-
gendwie abgründige und auf eigenartige astronomische
Überlegungen gegründete Philosophie:
V 133der ein Liedler offenbar ein professioneller
Liedersänger ist. Seine Tragödie fängt so an:
IV nur 33
Er irrt umher, "den Tod sich zu erstreiten", aber das gelingt
nicht, und er kehrt zurück, wo die edle Maid Milla, für die
er zu schlecht war, einen ebenso edlen Ritter heiraten
soll. Die Sache geht übel aus:
IV 41 - 44
Die ernste Frage ist, wie ein Komponist vom Range Schuberts
sich dazu entschließen konnte, auf diesen von Bürger in-
spirierten dilettantischen Schwulst etwa 600 Takte Musik
zu verschwenden.
Derselbe Kenner hat sich an einem "Fräulein versucht,
das schaut vom hohen Türm"
IV 152
morbiden Ton vieler seiner
Gedichte, erhöht jedoch leider
nicht ihre sprachliche Würde.
10
Eine Freifrau Caroline Louise von Klenke läßt die
emotionelle Temperatur verwegen in die Höhe gehen:
"Heimliches Lieben":
IV 104
Wiederum gibt es zu denken, daß Schubert sich 1827, also
zu einer Zeit, da er nach der Ansicht vieler Biographen
seinem nahe bevorstehenden Tod ins Auge sah, von diesem
eher kitschigen Erotikon angeregt fühlte. Vielleicht
hat ihn dessen einziger origineller Zug, die verkürzte
letzte Zeile in jeder Strophe, interessiert. Jedenfalls ist
die Musik zu diesem wollüstigen Erguss für Schubertsche
Verhältnisse eigentümlich kühl und gelassen.
Jenun, Schubert hat auch das folgende Gedicht in das
Stammbuch eines Freundes komponiert:
V 169
Der Dichter heißt - Franz Schubert.
Wir wollen uns hier weder über Schubert noch über die
unglücklichen Dichterlinge lustig machen, die ja gar nicht
ahnten, daß sie durch ihn einer lästernden Nachwelt
zur Schau gestellt werden würden. Was uns interessiert,
ist, wieso ein Mann von Schuberts Kaliber sich von solchen
Reimereien zu unausgesetzt erneuerten schöpferischen
Anstrengungen gereizt fühlen konnte. Es läßt sich kaum
anders erklären als durch die Annahme, daß er bis
zu völliger Widerstandslosigkeit an-
regbar war. Ob Goethe, Schiller,
Seidl, Collin, Schober, oder schließlich
Mayrhofer - wer immer vom Fischen, vom Wasser, von
den Fischen Kähnen und den Wellen dichtete, Schubert
konnte nicht widerstehen, und hatte
ein neues Exemplar aus dem unerschöpflichen
Katalog seiner Wassersymbole herbeizuschaffen.
Seine Musik leuchtet, wie die Sonne über Gerechte
und Ungerechte; und das Sprudelgehudel eines
Winkelpoeten ist ihm ebenso willkommener Anlaß
zu musikalischen Wasserpantomimen wie das ma-
jestätische Gewoge eines Dichterfürsten.
sein besonderes Talent
für die Darstellung
musikalische Sym-
bolisierung
Schulze oder Müller,
11
So weit wir es überblicken können, ist noch nicht oft
beobachtet worden, eine wie große Zahl von Schuberts Liedern
in Wirklichkeit musikdramatische Vorstudien zur Oper
darstellen. Das zeigt sich am deutlichsten in den umfang-
reichen Gesängen zu den Texten aus "Ossian", obwohl auch
manche andere Lieder, etwa die Fragmente aus Goethes
"Faust", dialogische Behandlung und dramatische Gestiku-
lation aufweisen. Die Ossian-Gesänge, die über sechzig
enggedruckte Seiten füllen, sind viel zu lang, um im
Detail besprochen zu werden. Es läßt sich jedoch sagen,
daß die bei Schuberts In dieser Hinsicht Darin ist Schuberts
dramatischer Stil in eben dem Grad fortschrittlich als er
sich rückwarts zu orientieren scheint an den Modellen
des alten großen Monteverdi. Schuberts eminentes großes Talent
für wendiges Manövrieren im tonalen Raum kommt
seinem offensichtlichen Wunsch nach äußerster Sensibilität
in der Ausdeutung schnellen wechselnder, subtiler Regungen
sehr entgegen, und seine metrische Flexibilität
macht die ariosen Abschnitte biegsam und abwechs-
lungsreich genug, um sie der harmonischen Unruhe
der Recitative anzugleichen.
ex
Wenn man sich zu erklären versucht, warum Schu-
bert trotz so vieler musikdramatischer Erfindungs-
gabe und so heißem Bemühen auf dem musikalischen
Theater innerlich wie äußerlich erfolglos blieb, so läßt
sich vielleicht sagen, daß etwa die mit wirklicher Phan-
tasie behandelten Ossian-Texte einigermaßen ge-
schwollene Literatur sind, an welcher den Komponisten
vermutlich in ersten Linie die Naturbilder reizten. Daß
12
Daß sich — für uns unbegreiflichenweise — doch ein weiteres
Publikum für diese Geisterbeschwörungen auf der
schottischen Heide interessiert haben muß, beweist das
Faktum, daß der als geschäftstüchtig genug bekannte
Wiener Verleger Diabelli einige der unvollendet ge-
bliebenen Ossian-Szenen nach Schuberts Tod mit Frag-
menten aus anderen Kompositionen von Schubert auf-
füllte, um sie an den Kunden zu bringen.
Auf der anderen Seite scheint es, daß Schubert, wenn
er wirklich für die Bühne schrieb, irgendwelchen Hem-
mungen unterworfen war, die seinen theatralischen
Arbeiten ein unglückliches Element von Hausbackenheit
und Pedanterie aufzwingen.
Wenigstens ein kurzes Beispiel aus dem schier langen
endlosen Elaborat "Der Tod Ossians" Ossian-Gesang "die Nacht" mag Schuberts
Arbeitsweise illustrieren
ex. IV 162
Gewiß handelt es sich hier bei den Ossian-Liedern um ein Jugendwerk
des Zwanzigjährigen, aus dem Jahr 1817, aber ge-
messen an der kurzen Spanne seines Lebens, ist das hier
schon ein Stadium gewisser Reife erreicht. Diese
Ossian - Dichtungen Texte erscheinen uns gewiß als schwülstige
Pseudo-Literatur und wir glauben zu verstehen, daß eine
musikalisch-dramatische Befassung mit ihnen
kaum sehr ergiebig sein wird.
Dabei hat ex. p. 163
8
13
- "vom Baum beim Grabe der Toten tönt der Eule
klagender Sang"- ex. p. 164 - "die verwelkte,
zum Knäuel verworrene Klette treibt der Wind über
das Gras "- p. 166 "es ist der leichte Tritt eines
Geists" p. 166. Von einer Charakterisierung der
Personen, die in diesen balladesken Dialogen auftreten,
ist freilich viel weniger zu bemerken. Ob Shilrik oder
seine Geliebte Vinvela, ob die feindlich-freundlichen
Brüder Oscar oder Dermid singen, läßt sich musi-
kalish kaum unterscheiden.
Über die innere und äußere Erfolglosigkeit des
Theaterkomponisten Schubert ist schon so viel nachgedacht und
geschrieben worden, daß weitere Erklärungsversuche
sich erübrigen dürften. Jedoch, da alle Theorien
dieser Art spekulativ sind und an einer an sich
bedauerlichen Tatsache nichts ändern, so mag hier
eine weder mehr noch weniger stichhaltige riskiert
werden. Ein Vergleich mit Beethoven und Mozart wird uns
dem Gegenstand vielleicht näher bringen. Kaum jemand dürfte
zögern, Beethoven einen dramatischen Komponisten zu nennen.
Seine Sinfonien sind Monumente gewaltiger Spannungen,
voll von explosiven Kontrasten kraftgeladenen Anti-
thesen, die das tragische Aufgewühltsein des Menschenlebens
symbolisieren wie kaum ein künstlerisches Bekenntnis
seit Michelangelo oder Shakespeare. Und doch hat
dieser Komponist nicht vermocht, seine ausgesprochenen
dramatischen Impulse auf der Opernbühne zu über-
zeugender Wirkung zu bringen. Die große und mehrfach
unter Schmerzen wiederholte Austrengung des "Fidelio"
ergibt einige wundersame Musikstücke, aber keinen
mitreißenden dramatischen Fluß. Schon der Entschluß,
ein so unmögliches Libretto wie den Fidelio in Musik
zu setzen, verrät eine souveräne Gleichgültigkeit gegenüber
14
den elementaresten Anforderungen der Musikbühne.
Aber gerade dieser Entschluß macht Beethovens Inter-
Im Gegensatz zu Beethoven ist Mozart ein theatralischer
Komponist, dessen Interese an den zahllosen Individuen,
die Gottes großen Tiergarten ausmachen, unerschöpflich ist.
Man hat den Eindruck, daß es ihn wenig interessiert, ob
Leporello ein gewisses ethisches oder soziales Prinzip
symbolisiert — was ihn zu den wundersamsten Erfin-
dungen bei der musikalischen Ausstattung dieser Partie bewegt, ist
seine unaufhörliche Freude an der Vorstellung, was dieser
Leporello doch für ein saftiger Kerl ist, wieviel
gefühlsmäsige und idiomatische Nuancen in ihm stecken,
wie er sich wohl in dieser oder jener Situation benehmen
wird, kurzum, was für ein Individuum er ist. Das sind
die Züge, die einen wirklichen Theaterkomponisten ausmachen.
Man findet sie wieder bei Verdi und Puccini, in etwas
anderer Ausprägung auch bei Wagner.
Das Schubert hingegen scheint sich mit den Charakteren, die
ihm die dramatischen Sujets bieten, kaum irgendwie zu
identifizieren, und gerade darin liegt wohl der wesentliche
Unterschied zwischen dem Dramatiker und Theatraliker
einerseits und dem Lyriker andrerseits. In einem
gewissen Sinn ist der Lyriker objektiver als die beiden
anderen, da er die menschlichen Gemütszustände und Gefühls-
15
regungen, die die Gegenstände seiner künstlerischen Gestal-
tung sind und ihn zu dieser anregen, von dem einmaligen,
individuellen Subjekt, in welchem sie sich manifestieren, ab-
löst und gewissermaßen abstrakt darstellt. Das lyrische
Subjekt der Müller-Lieder ist kein bestimmter Müllerbursche,
den eine Freilich Sie sind Träger von Empfindungen, und
diese freilich leben herzergreifend und schwingen in
jedem Ton der zauberhaften Musik, zu der sie An-
laß gaben. Der pragmatische Hintergrund dieser Emp-
findungen ist oft unerheblich obskur, banal, kleinlich, lächerlich,
aber auf jeden Fall unerheblich. Darum tut es auch
uns so wenig nichts zur Sache, wie es offenbar auch Schubert
nicht bekümmerte, daß die Empfindung in vielen Fällen in
einer abgeschmackten und beinahe albernen sprachlichen
Fügung ausgesprochendrückt war. Ihn intereressiert es
wenig, warum und wodurch ein Mensch enttäuscht wurde, und noch
weniger, was das für ein Mensch das ist, sondern nur, welche
Nuancen und Gefühlsschwebungen sich als Reaktion er-
geben, wenn der enttäuschte Mensch auf einen gefrorenen
Fluß starrt.
16
Merkwürdigerweise treten die Konturen individueller, konkre-
ter Persönlichkeit noch am ehesten hervor in manchen jener
Lieder, die vom Dramatischen am weitesten abstrahiert sind.
Jenes große Lied "Delphine", das wir früher betrachtet haben,
hat starke gestische Momente und eine Direktheit der Aus-
drucksintensität, mit denen eine Bühnendarstellerin schon
viel anfangen könnte. Ein anderes, aus dem selben Drama
"Lacrimas" exzerpiertes Lied, "Florio", hat ähnliche Züge.
Auch der Dialog zwischen dem Zwerg und der Königin in
der Ballade, die wir besprochen haben, hat theatermäßige
Eindringlichkeit und weist den beiden Partnern klar pro-
filierte Ausdruckscharaktere zu. Damit verglichen wirken
die Ossian-Gesänge, die wirklichen dramatischen Dialog
enthalten, trotz des Farbenreichtums ihrer Naturillu-
strationen merkwürdig steif, und das trifft noch mehr
zu auf Schuberts direkte Opernversuche.
Man könnte sagen, daß sein unvergleichliches Genie
sich in der Momentaufnahme der Gefühlsbewegungen
erschöpfte. Er kann die selbstverzehrende Qual der
liebenden Delphine darstellen wie kein anderer, weil
sie für ihn keine Geschichte hat. Wir wissen nicht, was
sie in den von uns Schubert beobachteten Moment gebracht hat,
und wir wissen nicht, was aus ihr werden wird, und
der Komponist weiß es ebensowenig. Es scheint, als ob es
seine Beobachtungs- und Erfindungsgabe lähmen würde,
wenn er mit der Kontinuität eines dramatischen Verlaufs,
mit den Verstrickungen in der Zeit sich entwickelnder Schick-
sale und mit dem geschichtlichen Werden von Persönlich-
keiten konfrontiert wird. Vielleicht hat das seine die Hemmungen
verursacht, die man in seinem Opernschaffen spürt und die die-
sem die Überzeugungskraft genommen haben. Wir haben uns
dabei über keinen Verlust zu beklagen, denn wir sind mit
dem, was er uns gab, reicher beschenkt als wir verdient
haben. Wenn wir diesen Fall besprechen und bedauern, so
geschieht es nur, weil Schubert selbst sich so sehr um die
Oper bemüht hat und weil ihm jeder zusätzliche Grad
von persönlicher Befriedigung zu gönnen gewesen wäre.