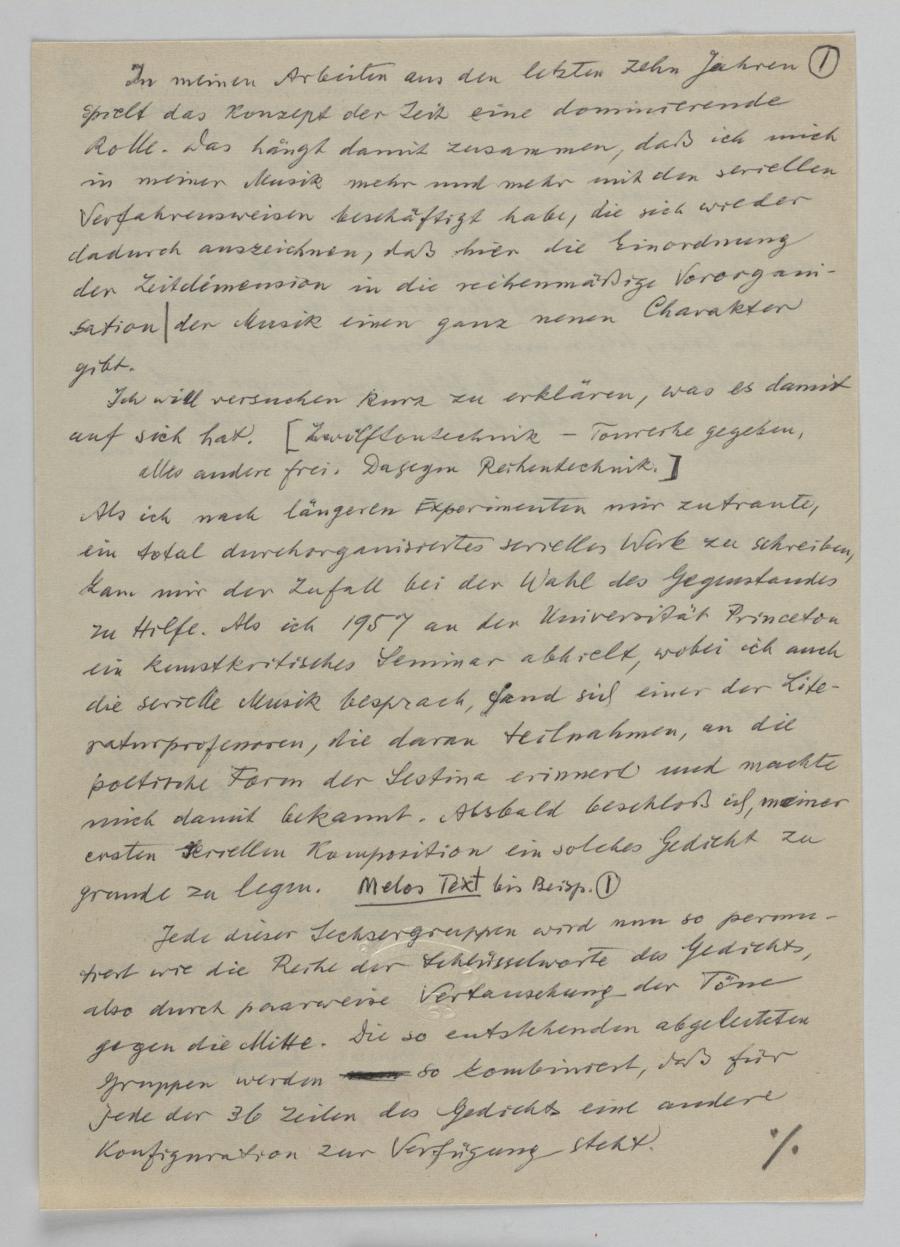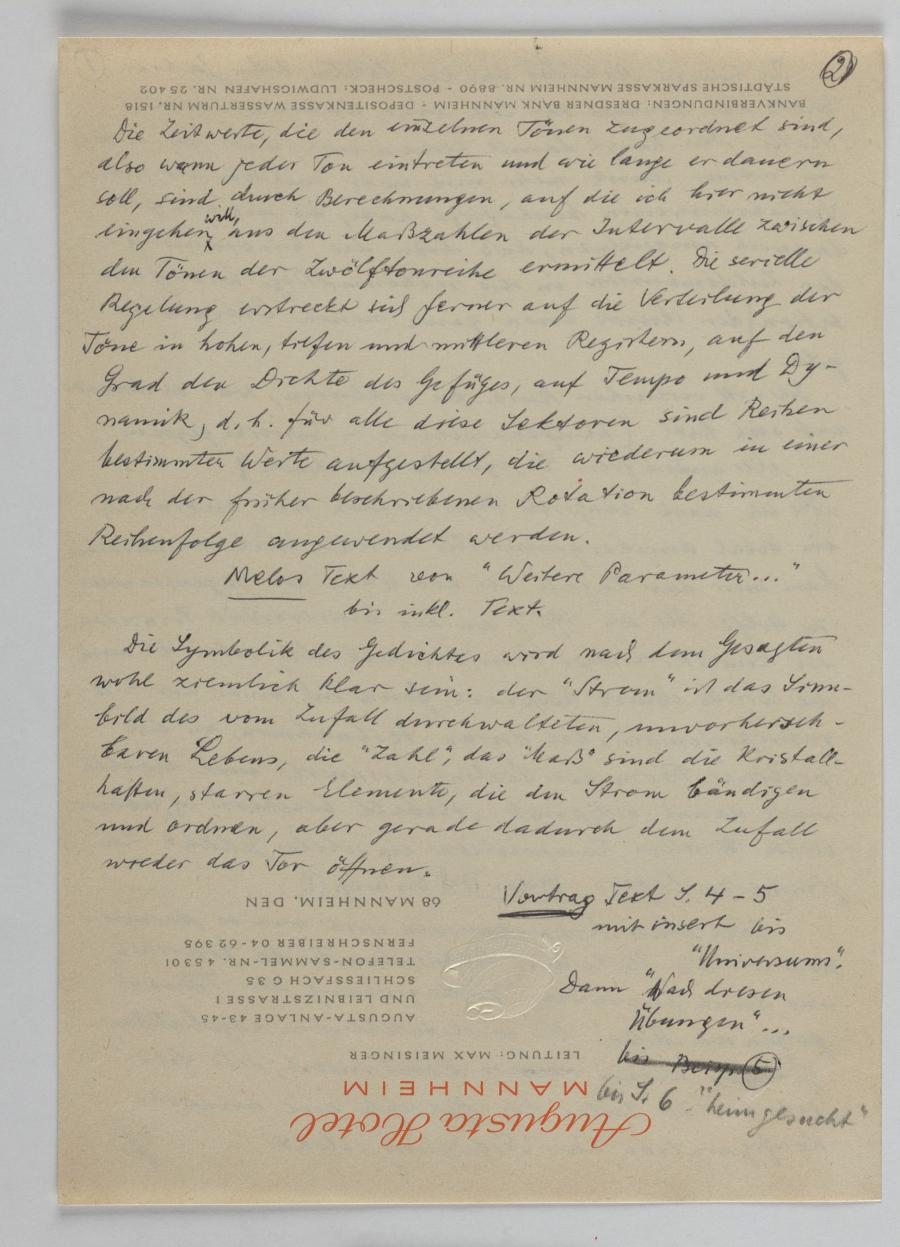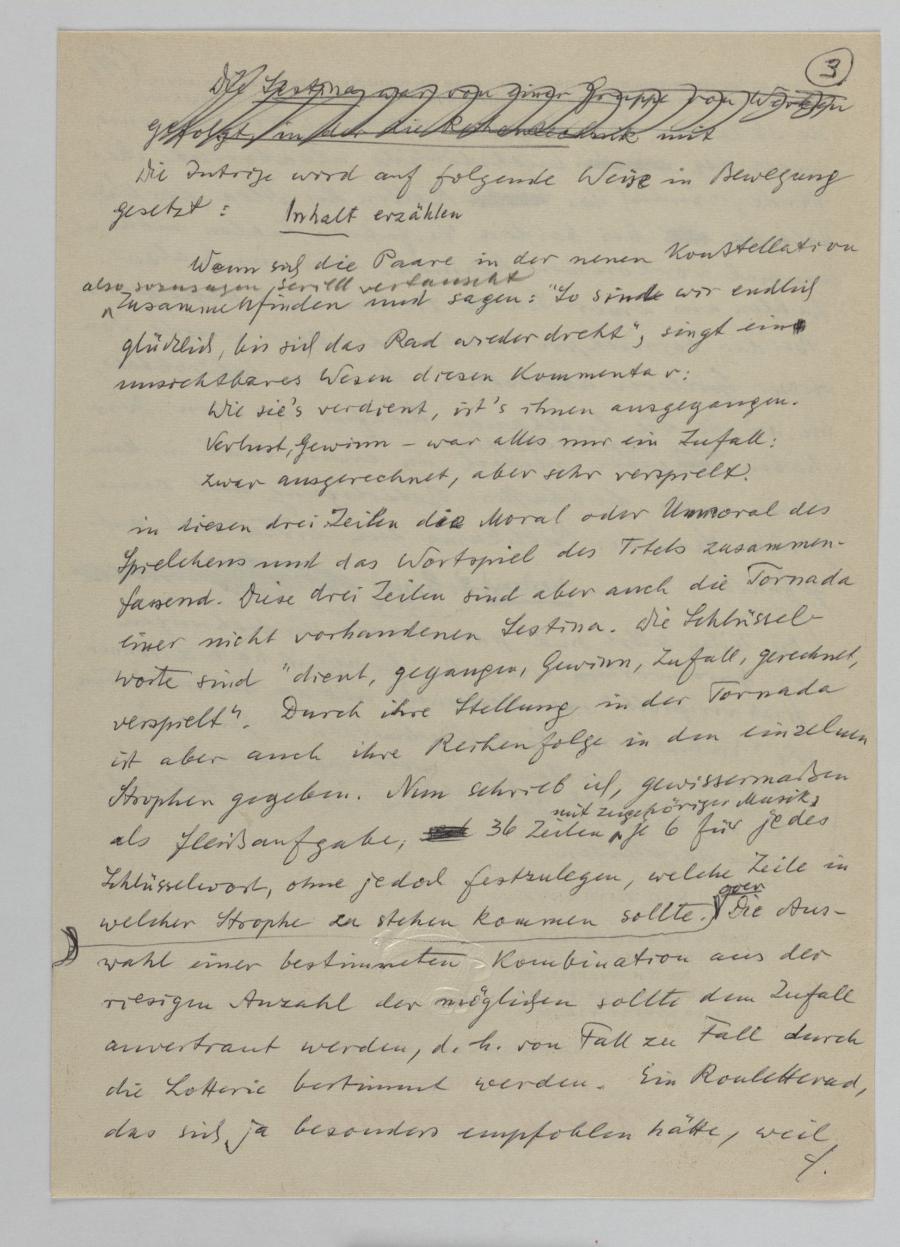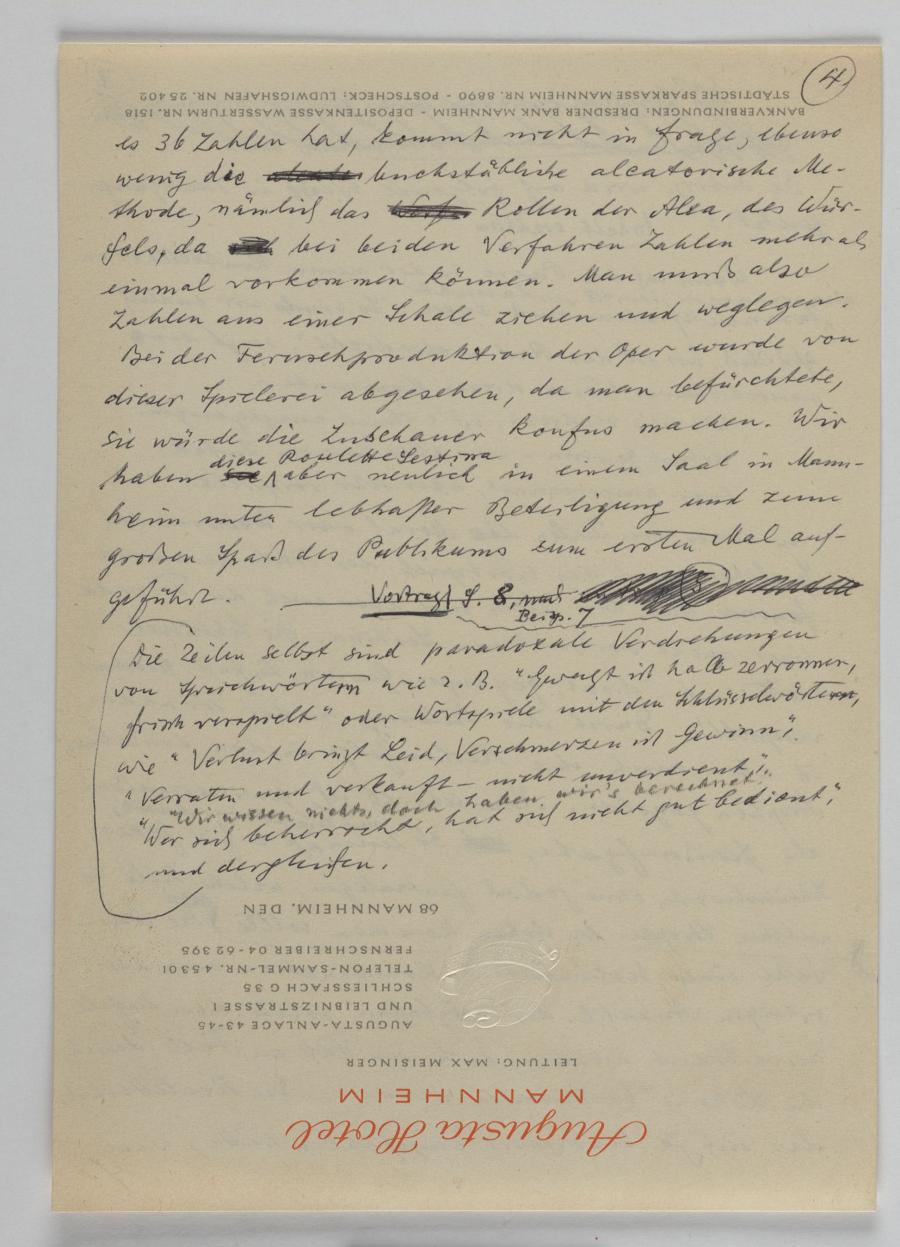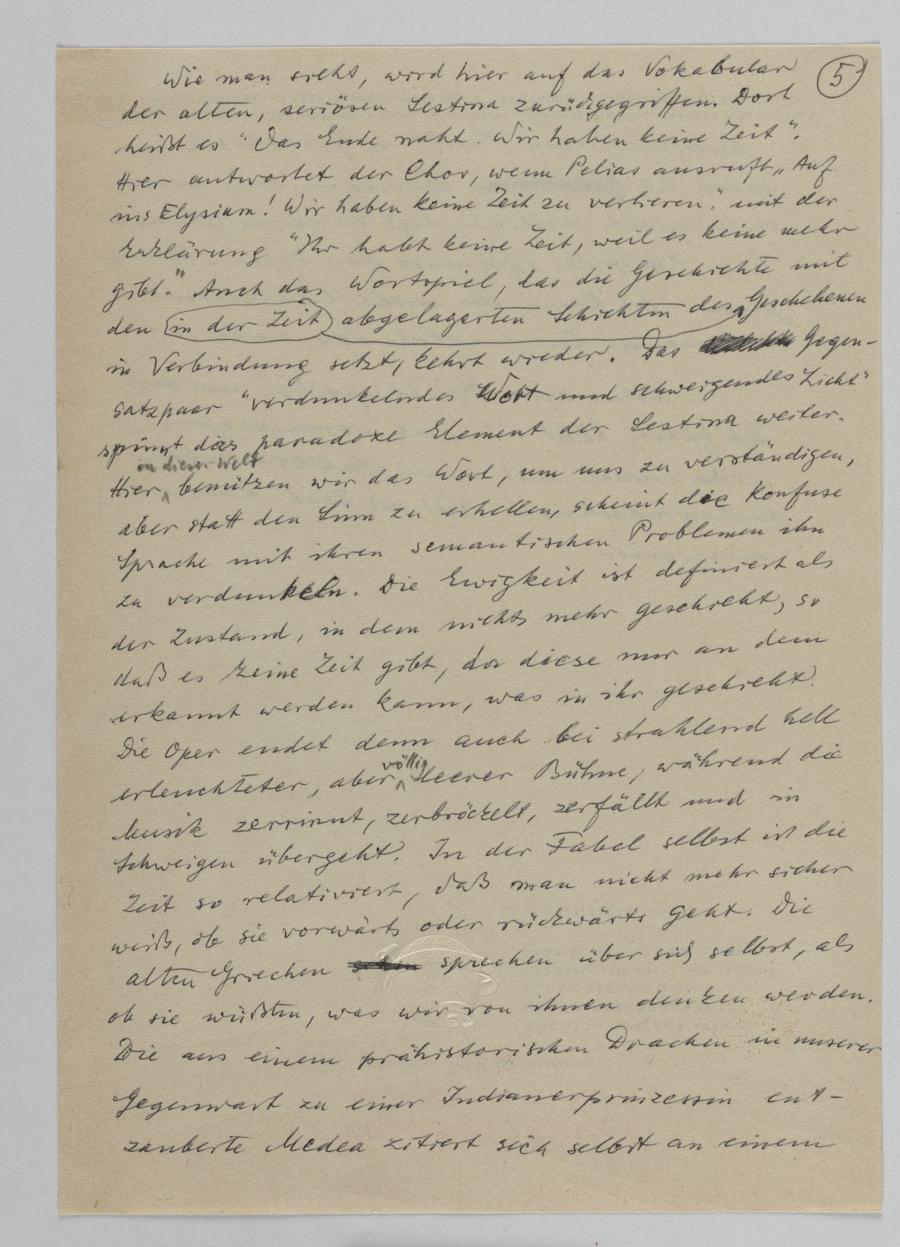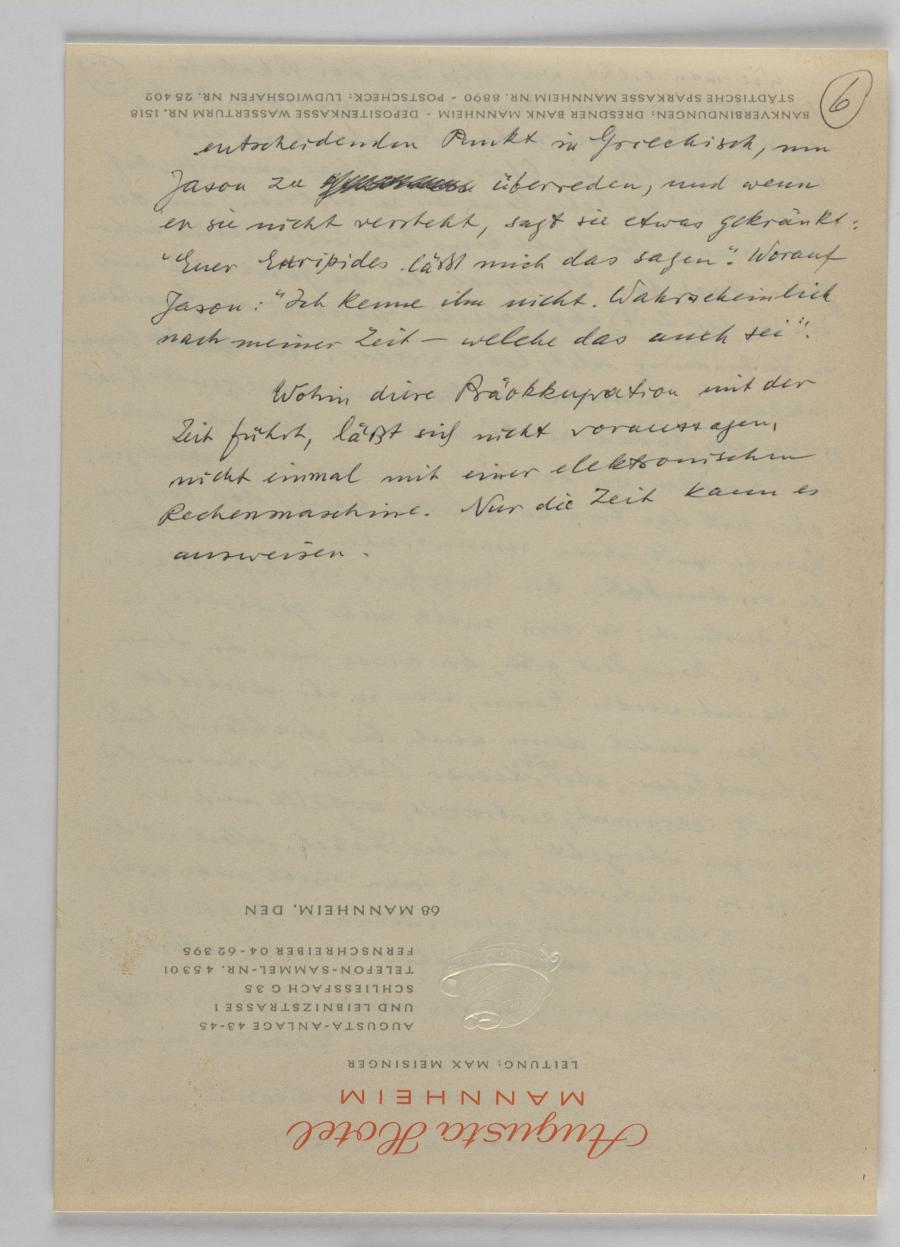[Zeit und Musik, Zwölftontechnik und Tonreihe]
Abstract
Die in diesem Dokument formulierten Textteile dienten offenbar als Notizen für einen nicht eindeutig identifizierbaren, ungefähr Mitte der 1960er Jahre gehaltenen Vortrag über serielle Verfahrensweisen. Anhand seiner eigenen Werke (Sestina, op. 161, die Opern „Ausgerechnet und verspielt“, op. 179 und „Der goldene Bock“, op. 186) erläutert er, wie inhaltliche Details der Texte mit musikalischen Verfahrensweisen korrespondieren.
Verweise auf Passagen anderer Texte, die entsprechend in diesem Vortrag integriert werden sollten, bzw. den Vermerk „Inhalt erzählen“ am Beginn des Abschnitts über „Ausgerechnet und verspielt“ lassen vermuten, dass es sich bei diesem Dokument um eine Entwurfsfassung handelt.
1
In meinen Arbeiten aus den letzten zehn Jahren spielt das Konzept der Zeit eine dominierende Rolle. Das hängt damit zusammen, daß ich mich in meiner Musik mehr und mehr mit den seriellen Verfahrensweisen beschäftigt habe, die sich wieder dadurch auszeichnen, daß hier die Einordnung der Zeitdemension in die rechenmäßige Vororgani- sation der Musik einen ganz neuen Charakter gibt.
Ich will versuchen kurz zu erklären, was es damit
auf sich hat. [Zwölftontechnik - Tonreihe gegeben,
alles andere frei. Dagegen Reihentechnik.]
Als ich nach längeren Experimenten mir zutraute,
ein total durchorganisiertes serielles Werk zu schreiben
kam mir der Zufall bei der Wahl des Gegenstandes
zu Hilfe. Als ich 1957 an der Universität Princeton
ein kunstkritisches Seminar abhielt, wobei ich auch
die serielle Musik besprach, fand sich einer der Lite-
raturprofessoren, die daran teilnahmen, an die
poetische Form der Sestina erinnert und machte
mich damit bekannt. Alsbald beschloß ich, meiner
ersten seriellen Komposition ein solches Gedicht zu
Grunde zu legen. Melos Text bis Beisp. 1
Jede dieser Sechsergruppen wird nun so permu-
tiert wie die Reihe der Schlüsselworte des Gedichts,
also durch paarweise Vertauschung der Töne
gegen die Mitte. Die so entstehenden abgeleiteten
Gruppen werden
2
Die Zeitwerte, die den einzelnen Tönen zugeordnet sind,
also wann jeder Ton eintreten und wie lange er dauern
soll, sind durch Berechnungen, auf die ich hier nicht
Melos Text von "Weitere Parameter ..."
bis inkl. Text.
Die Symbolik des Gedichtes wird nach dem Gesagten wohl ziemlich klar sein: der "Strom" ist das Sinn- bild des vom Zufall durchwalteten, unvorhersch- baren Lebens, die "Zahl", das "Maß" sind die Kristall- haften, starren Elemente, die den Strom bändigen und ordnen, aber gerade dadurch dem Zufall wieder das Tor öffnen.
VortragText S. 4 - 5 mit insert bis "Universums". Dann "Nach diesen Übungen"...
5
3
Sestina war von einer Gruppen von Werken
Inhalterzählen
Wenn sich die Paare in der neuen Konstellation
e
4
es 36 Zahlen hat, kommt nicht in Frage, ebenso
wenig die sie
VortragS.8, nach
5-
5
Wie man sieht wird hier auf das Vokabular
der alten, seriösen
6
entscheidenden Punkt in Griechisch, um
Jason zu
Wohin diese Präokkupation mit der Zeit führt, läßt sich nicht voraussagen, nicht einmal mit einer elektronischen Rechenmaschine. Nur die Zeit kann es ausweisen.