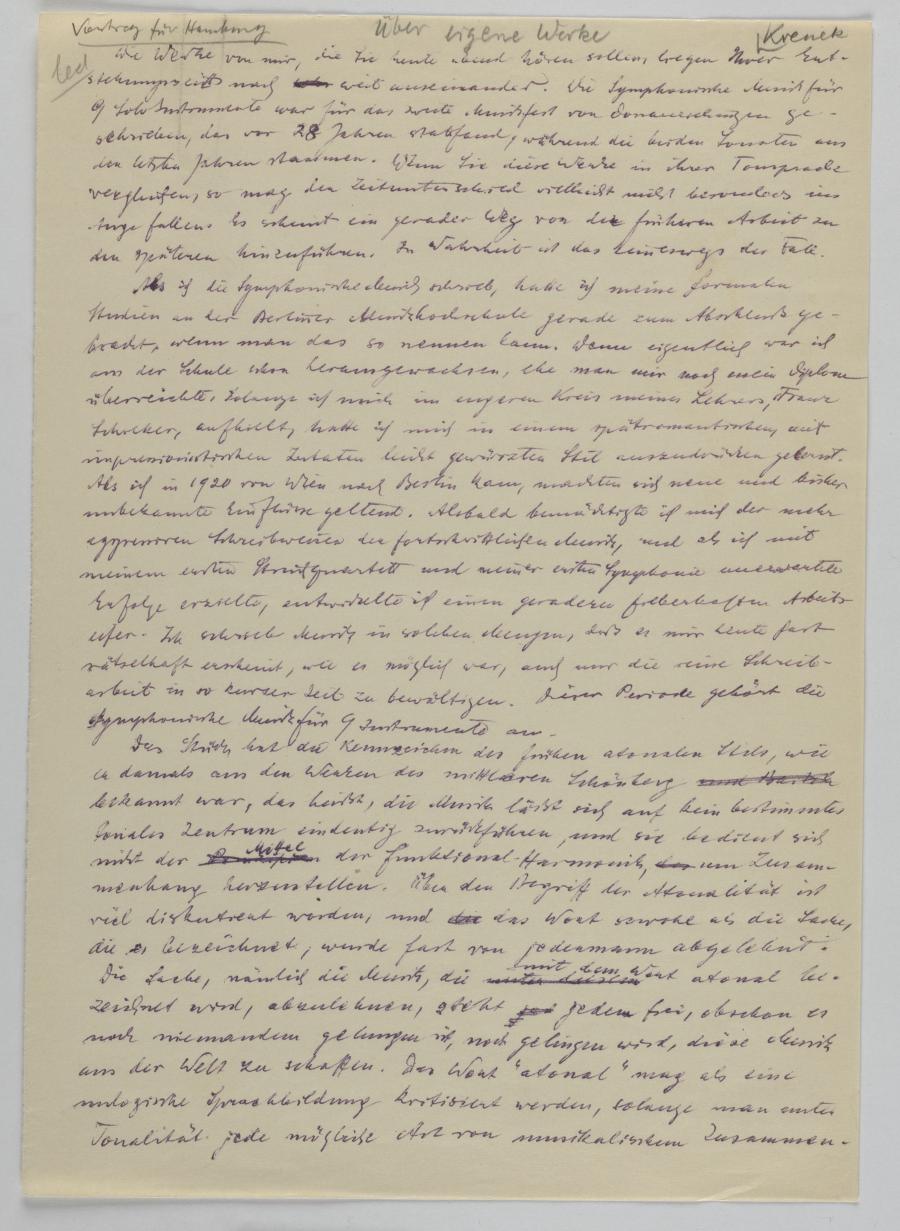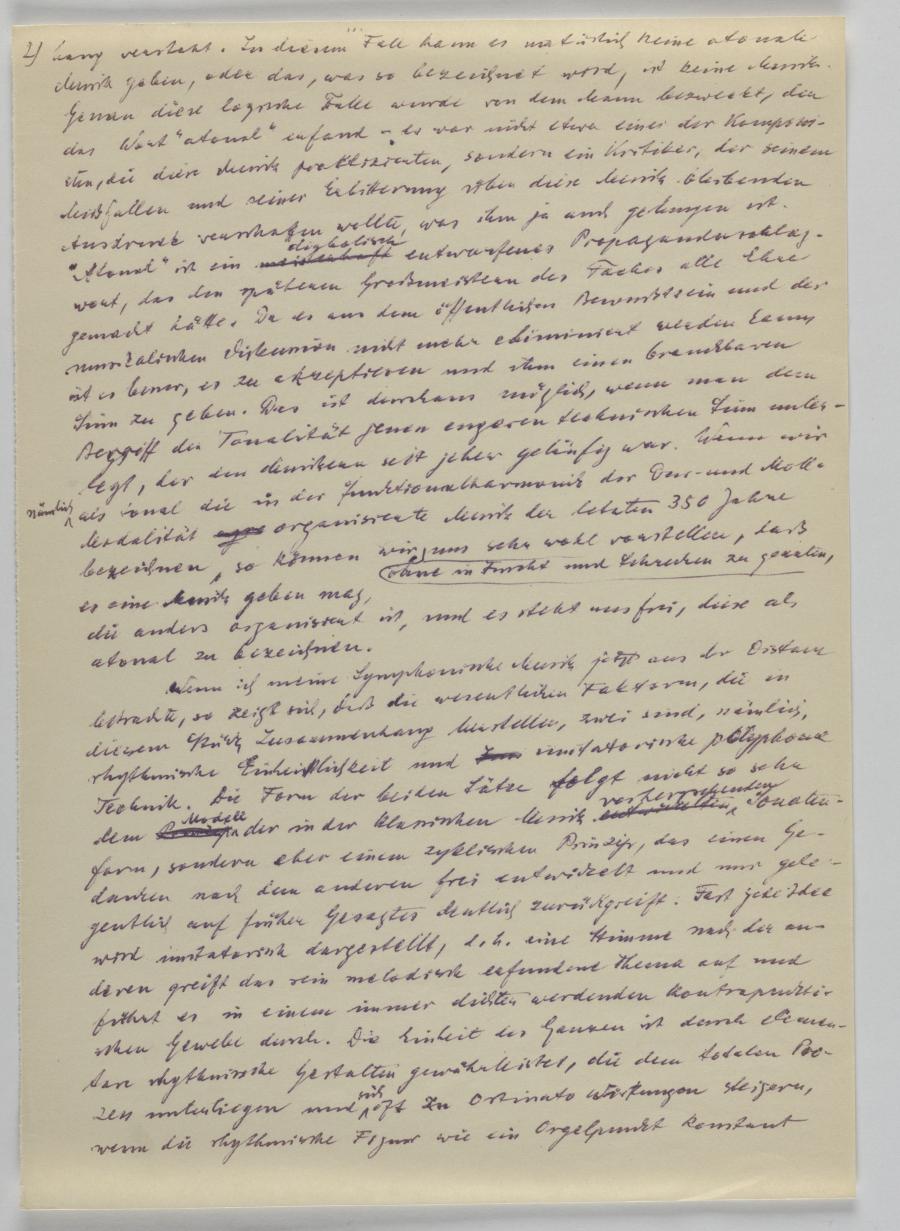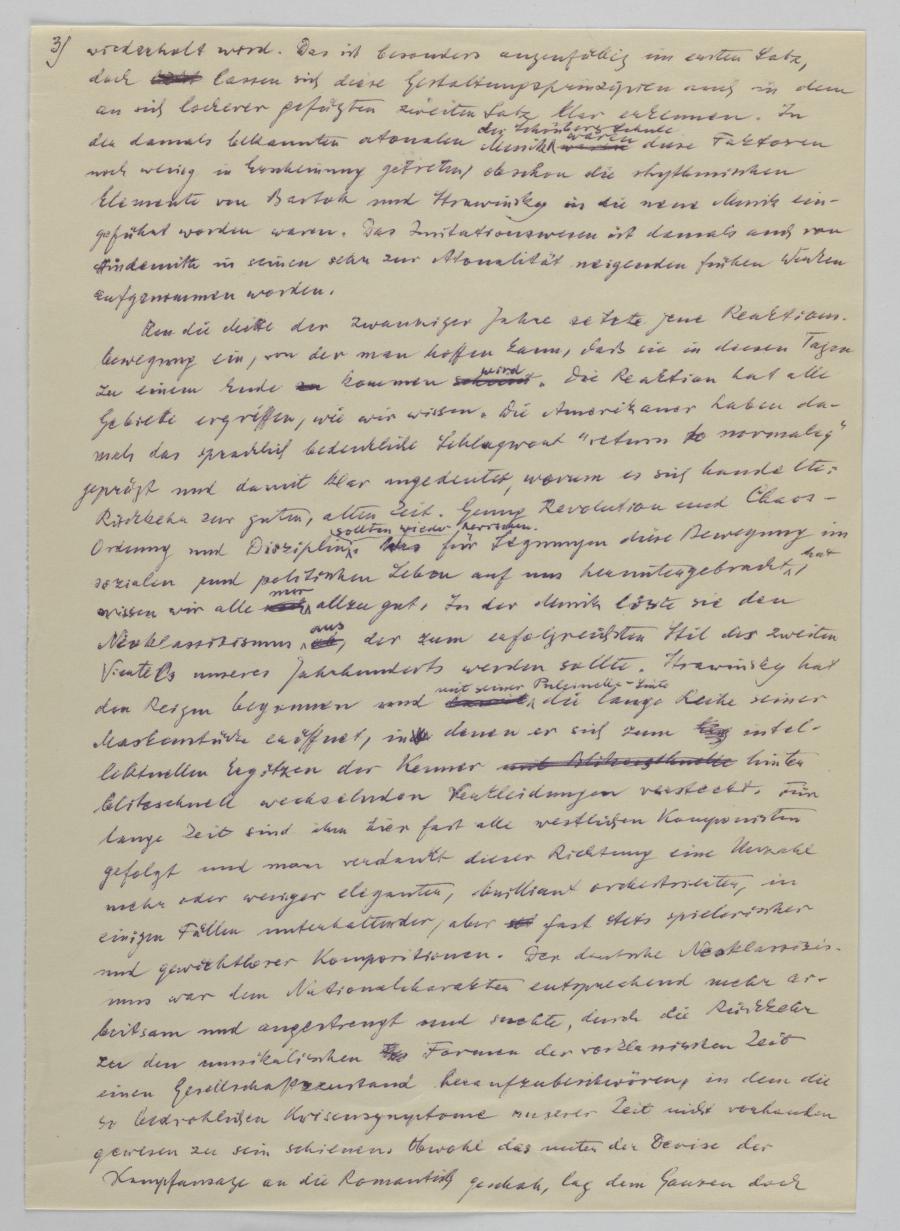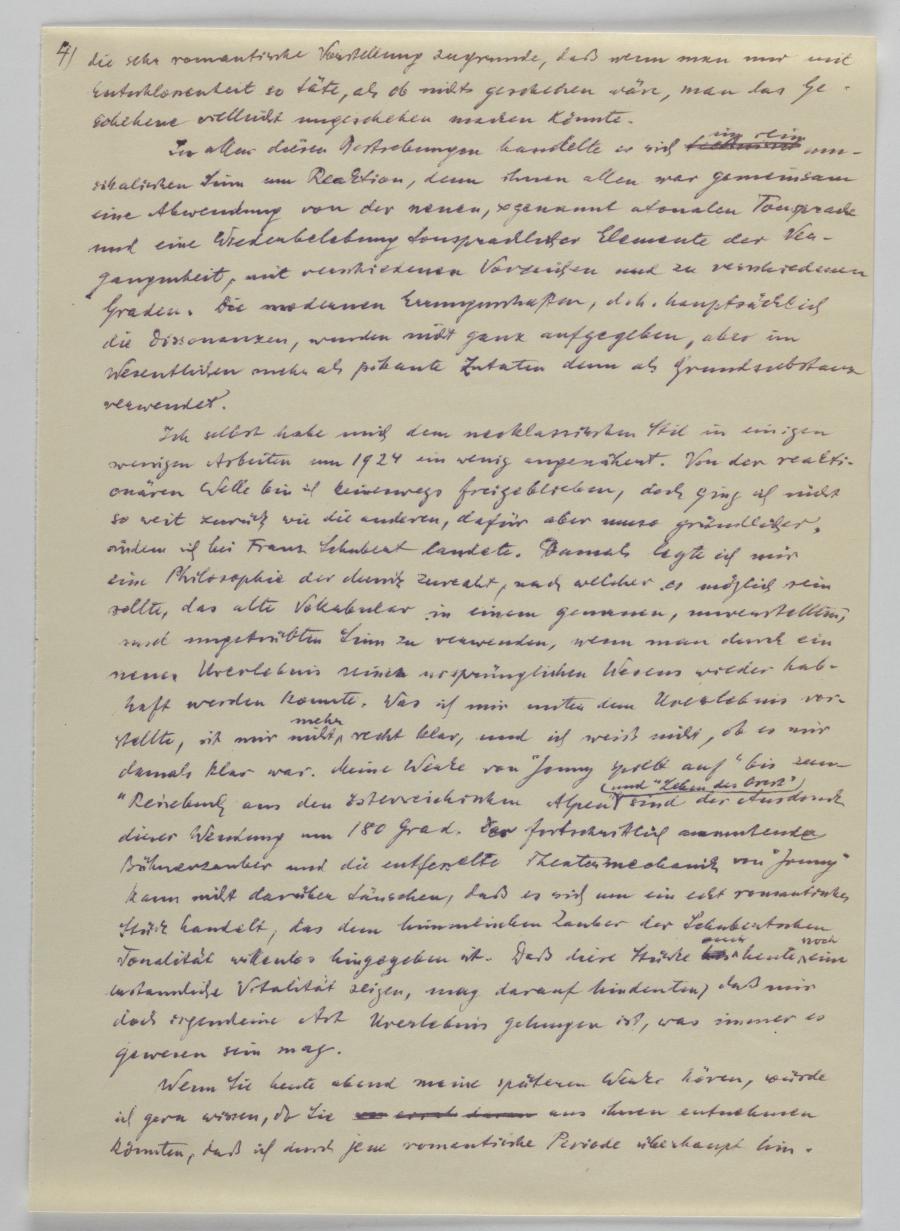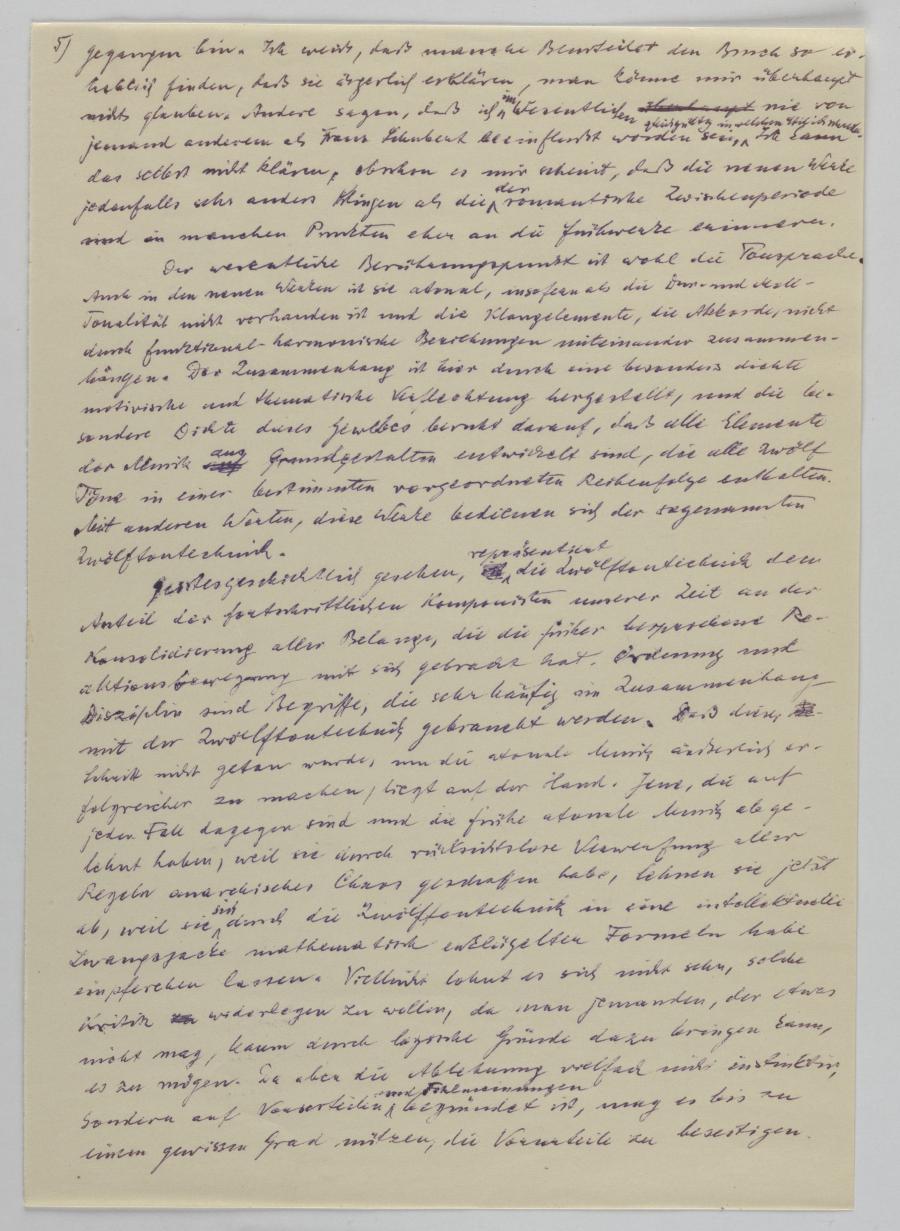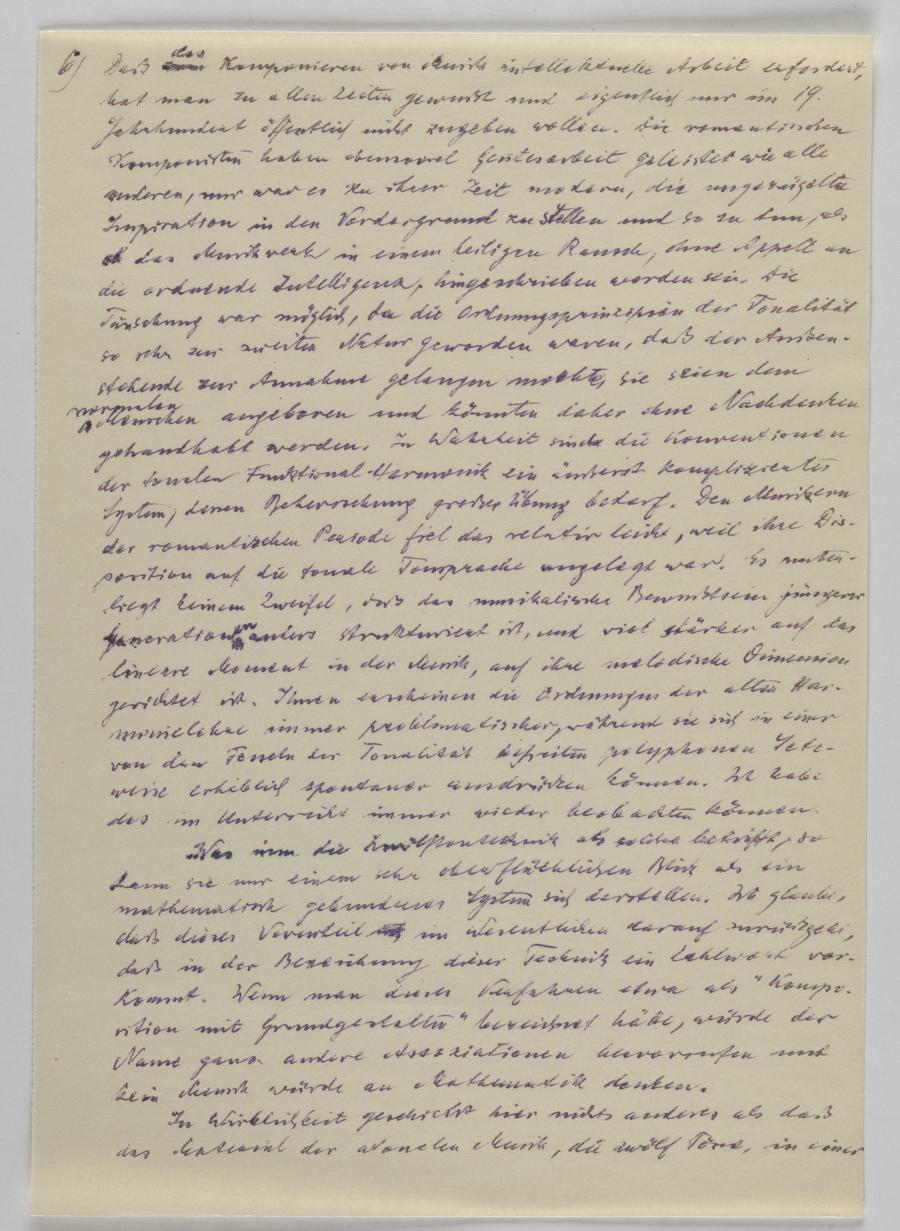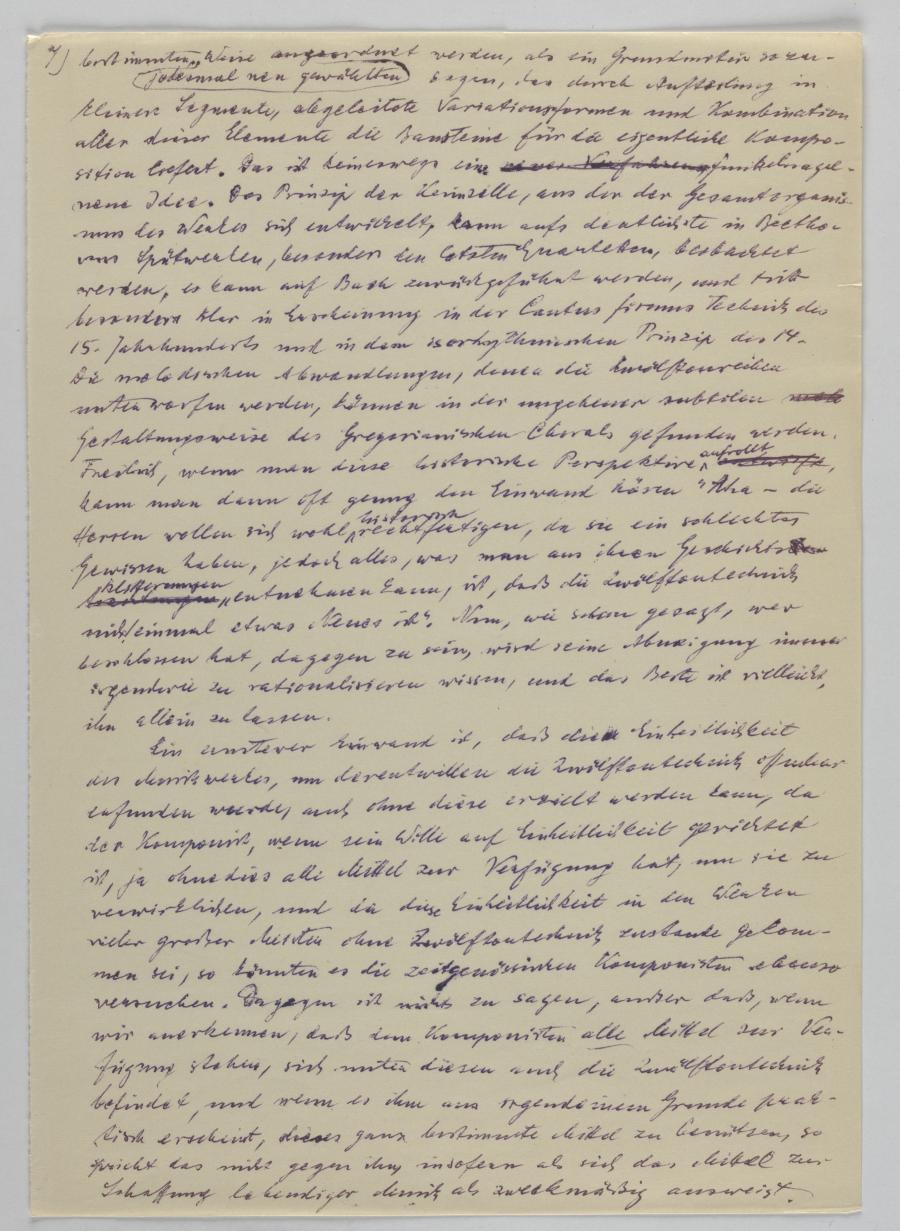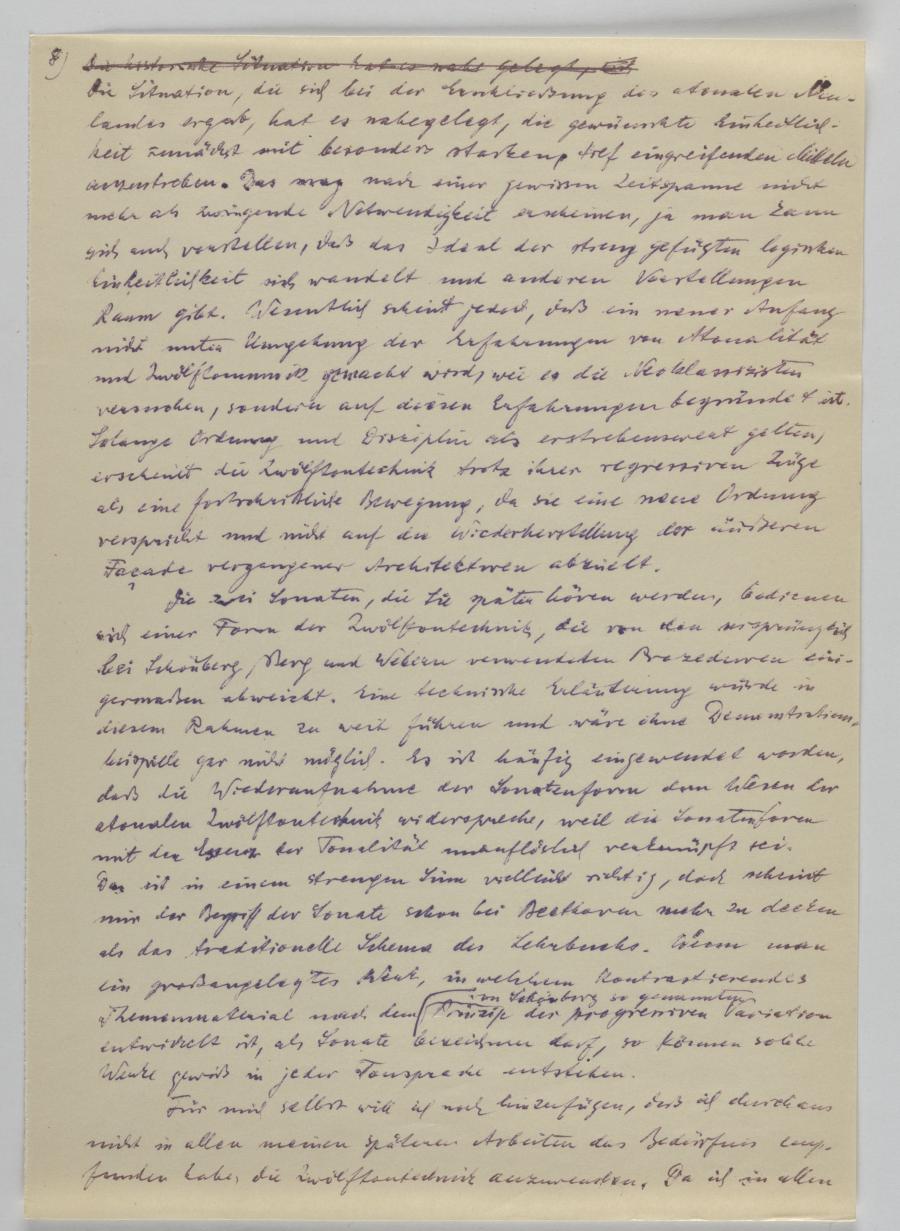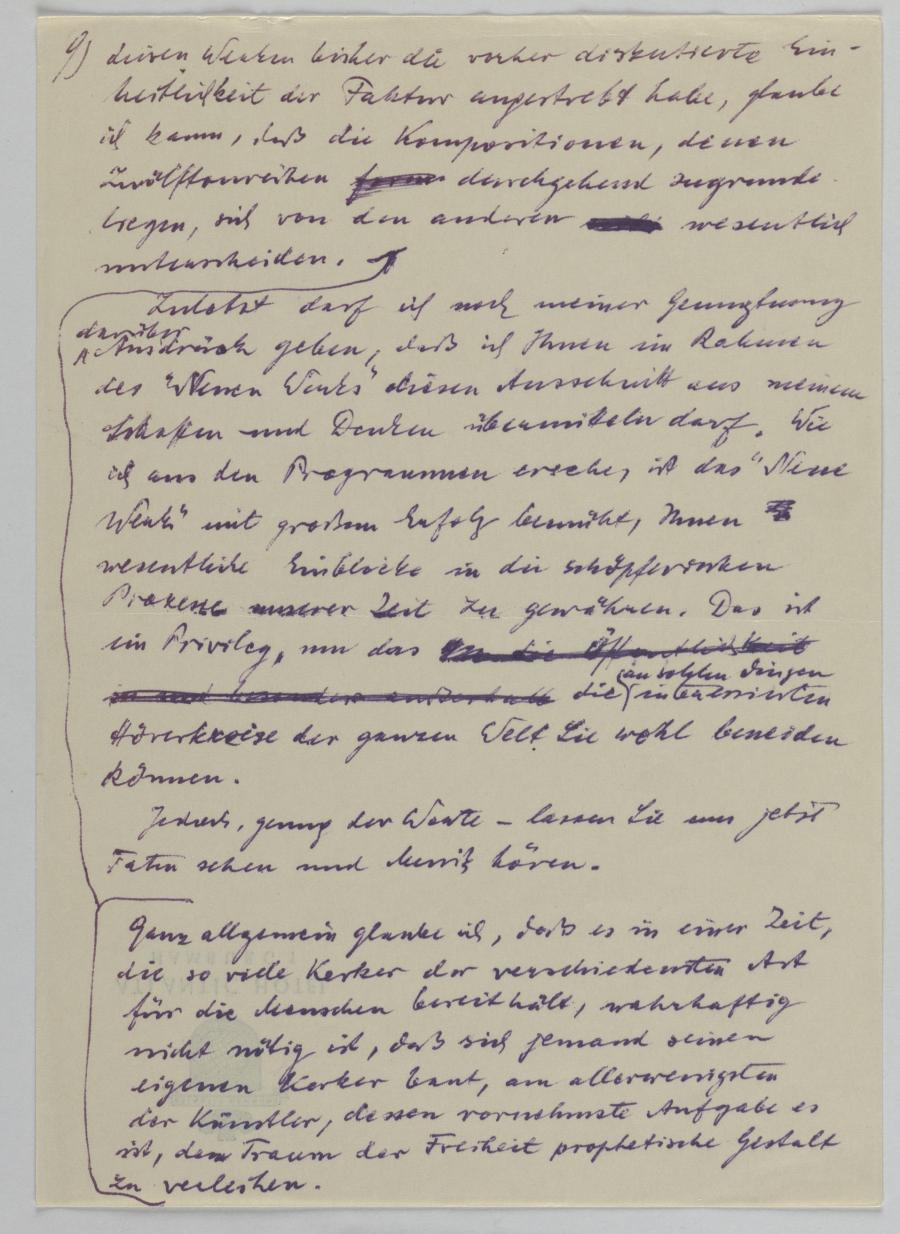Über eigene Werke
Abstract
Der folgende Vortrag wurde von Krenek als Einführung in eine Studioveranstaltung des Nordwestdeutschen Rundfunks am 7. Dezember 1951 in der Sendereihe „Das neue Werk“ gehalten. Krenek wirkte in dieser Veranstaltung auch als Dirigent und Pianist seiner eigenen Werke. Das Programm stellt die aus einer frühen, atonalen Schaffensperiode stammende Symphonische Musik op. 11 (1923) zwei zwölftönigen Sonaten (3. Klaviersonate, op. 92 Nr. 4; Sonate für Violine und Klavier, op. 99) gegenüber. Krenek bespricht die Werke sowohl hinsichtlich ihrer unterschiedlichen handwerklichen Gestaltungsprinzipien verortet sie aber auch im biographischen Entstehungskontext. Dabei grenzt er die im Programm gespielten Werke (und auch sich selbst) von seiner kurzen, auf Schubert zurückgreifenden neoklassizistischen Schaffensphase ab, und verteidigt gerade die Zwölftonmethode gegen häufig bemühte Vorwürfe.
Vortrag fürHamburg Über eigene Werke
lect
Die Werke von mir, die Sie heute abend hören sollen, liegen ihrer Ent-
stehungszeit nach
Als ich die
Das Stück hat die Kennzeichen des frühen atonalen Stils, wie
er damals aus den Werken des mittleren Prinzipien der umunter diesem
hang versteht. In diesem Fall kann es natürlich keine atonale
Musik geben, oder das, was so bezeichnet wird, ist keine Musik
Genau diese logische Falle wurde von dem Mann bezweckt, der
das Wort "atonal" erfand - es war nicht etwa einer der Komponi-
sten die diese Musik praktizierten, sondern ein Kritiker, der seinem
Mißfallen und seiner Erbitterung über diese Musik bleibenden
Ausdruck verschaffen wollte, was ihm ja auch gelungen ist.
"Atonal" ist meisterhaft
Wenn ich meine Prinzip entwickelten
wiederholt wird. Das ist besonders augenfällig im ersten Satz,
doch waren
Um die Mitte der zwanziger Jahre setzte jene Reaktions-
bewegung ein, von der man hoffen kann, daß sie in diesen Tagen
zu einem zu kommen scheint noch ab, der zumdamit
die sehr romantische Vorstellung zugrunde, daß wenn man nur mit Entschlossenheit so täte, als ob nichts geschehen wäre, man das Ge- schehene vielleicht ungeschehen machen könnte.
In allen diesen Bestrebungen handelte
Ich selbst habe mich dem neoklassischen Stil in einigen
wenigen Arbeiten um 1924 ein wenig angenähert. Von der reakti-
onären Welle bin ich keineswegs freigeblieben, doch ging ich nicht
so weit zurück wie die anderen, dafür aber umso gründlicher,
indem ich bei bis
Wenn Sie heute abend meine späteren Werke hören, würde
ich gern wissen, so Sie
gegangen bin. Ich weiß, daß manche Beurteiler den Bruch so er-
heblich finden, daß sie ärgerlich erklären, man könne mir überhaupt
nichts glauben. Andere sagen, überhaupt nie von
Der wesentliche Berührungspunkt ist wohl die Tonsprache.
Auch in den neuen Werken ist sie atonal, insofern als die Dur- und Moll-
Tonalität nicht vorhanden ist und die Klangelemente, die Akkorde, nicht
durch funktional-harmonische Beziehungen miteinander zusammen-
hängen. Der Zusammenhang ist hier durch eine besonders dichte
motivische und thematische Verflechtung hergestellt, und die be-
sondere Dichte dieses Gewebes beruht darauf, daß alle Elemente
der auf
Geistesgeschichtlich ist
zum
Was nun die Zwölftontechnik als solche betrifft, so
kann sie nur einem sehr oberflächlichen Blick als ein
mathematisch gebundenes System sich darstellen. Ich glaube,
daß dieser Vorurteil
In Wirklichkeit geschieht hier nichts anderes, als daß das Material der atonalen Musik, die zwölf Töne, in einer
7/
entwirftbe-
trachtungen
Ein ernsterer Einwand ist, daß die alle Mittel zur Ver-
fügung stehen, sich unter diesen auch die Zwölftontechnik
befindet, und wenn es ihm aus irgendeinem Grunde prak-
tisch erscheint, dieses ganz bestimmte Mittel zu benützen, so
spricht das nicht gegen ihn, insofern als sich das Mittel zur
Schaffung lebendiger Musik als zweckmäßig ausweist.
Die zwei Sonaten, die Sie später hören werden, bedienen
sich einer Form der Zwölftontechnik, die von den ursprünglich
bei
Für mich selbst will ich noch einzufügen, daß ich durchaus nicht in allen meinen späteren Arbeiten das Bedürfnis emp- funden habe, die Zwölftontechnik anzuwenden. Da ich in allen
9/
diesen Werken bisher die vorher diskutierte Ein-
heitlichkeit der Faktur angestrebt habe, glaube
ich kaum, daß die Kompositionen, denen
Zwölftonreihen
Zuletzt darf ich noch meiner Genugtung
in und besonders außerhalb die
Jedoch, genug der Worte - lassen Sie uns jetzt Taten sehen und Musik hören.