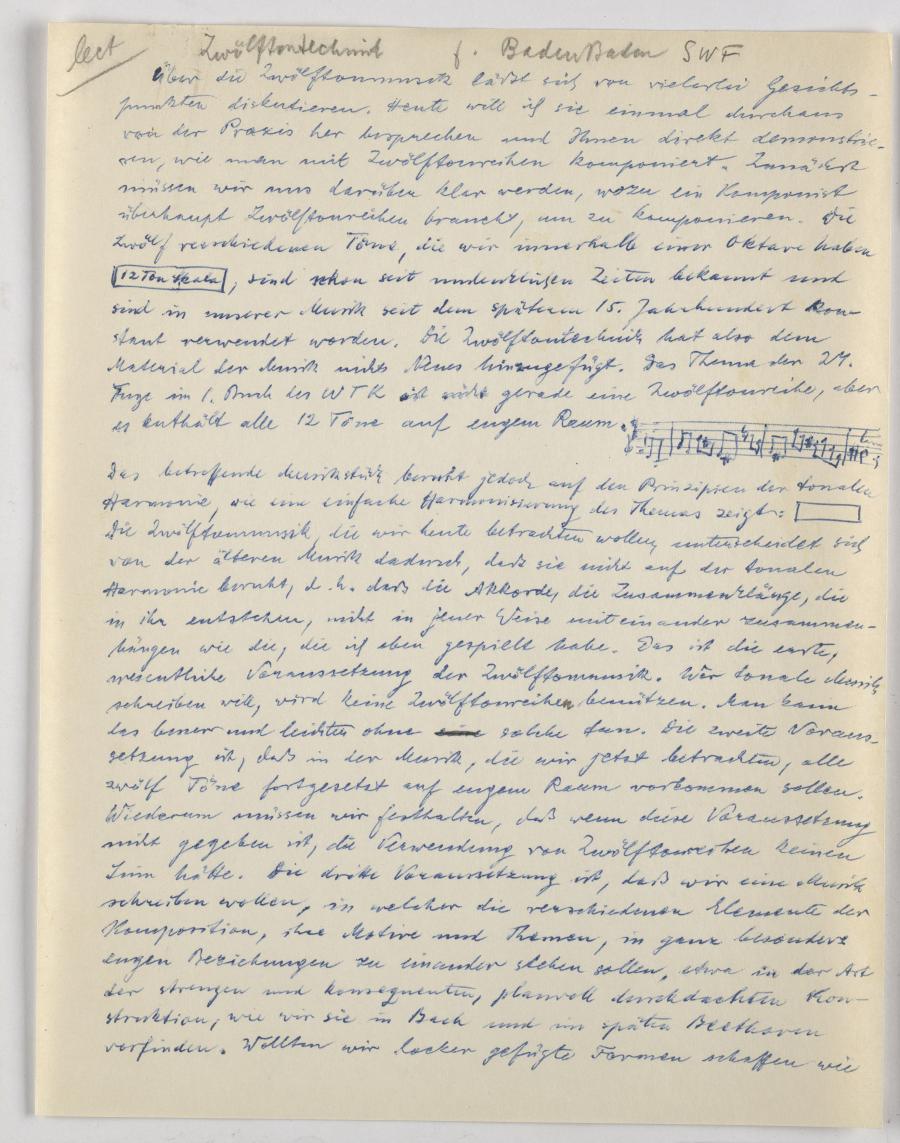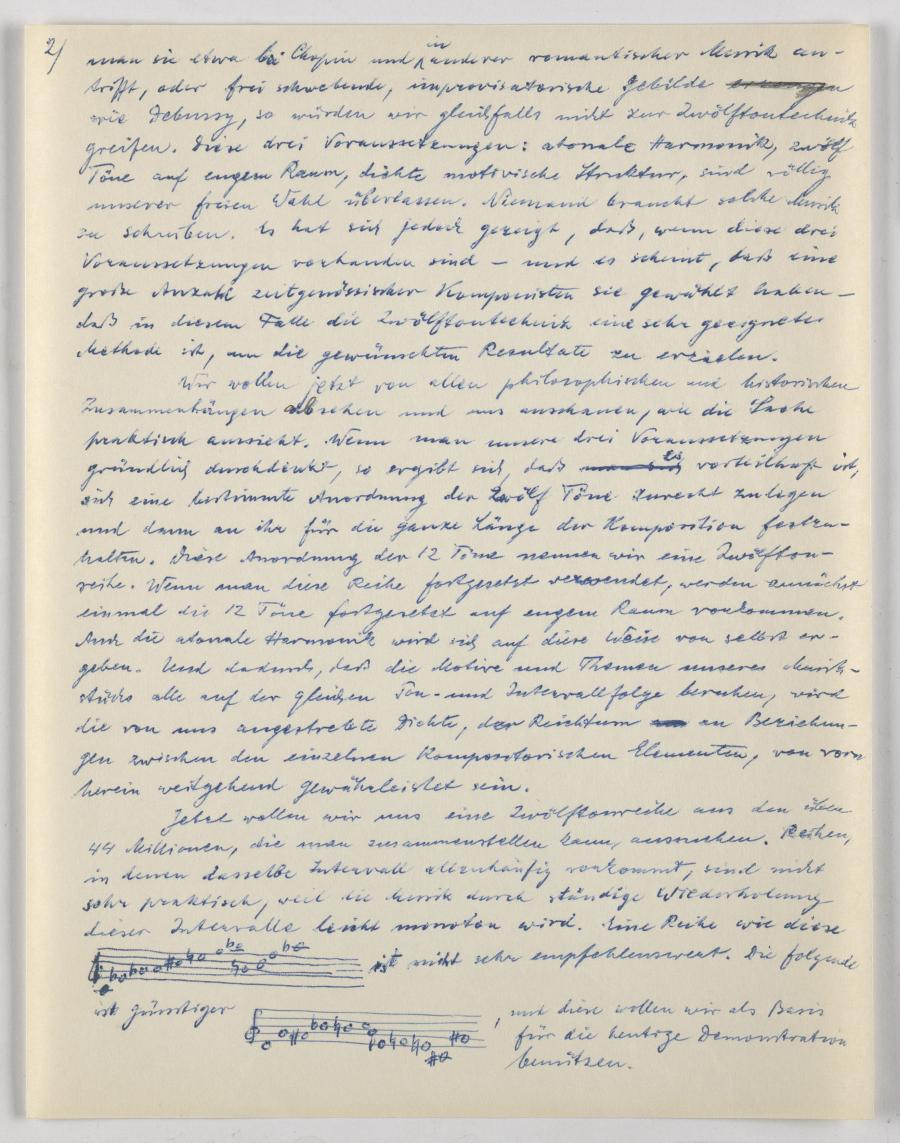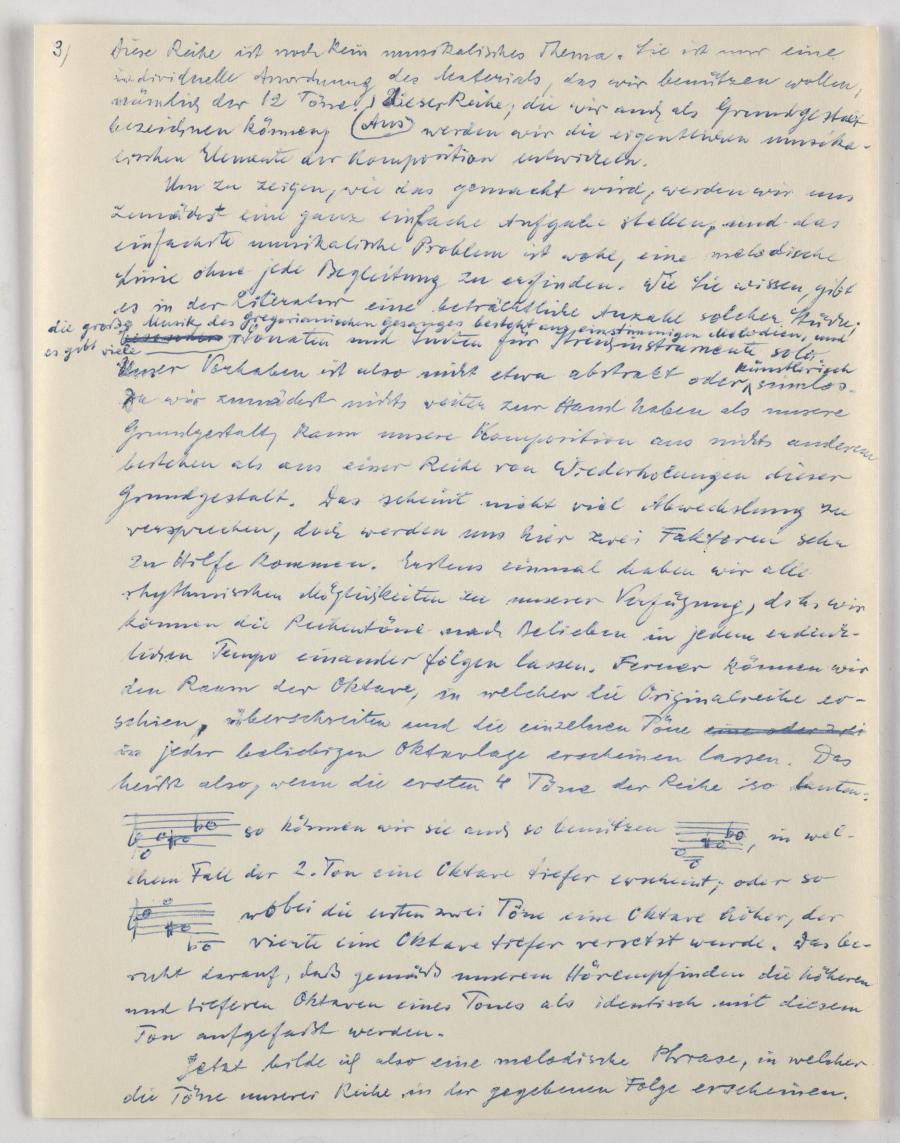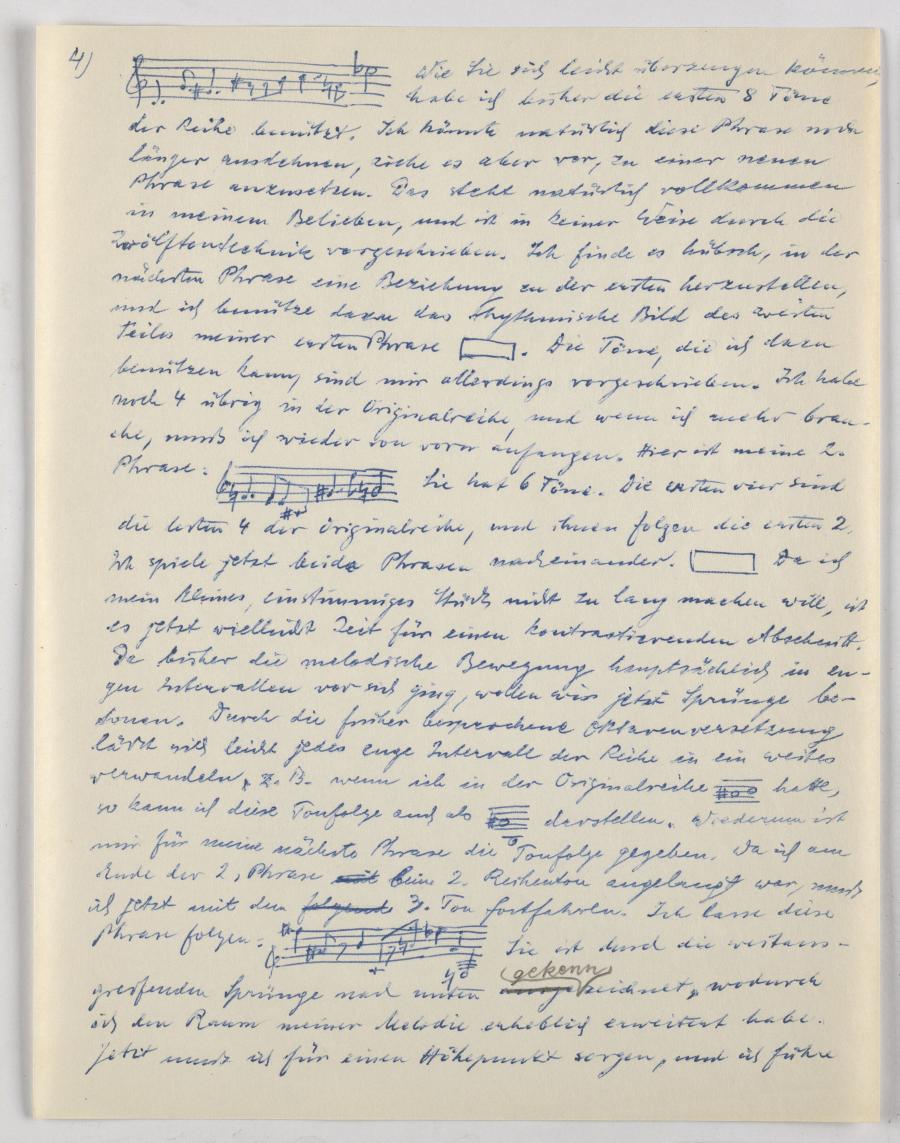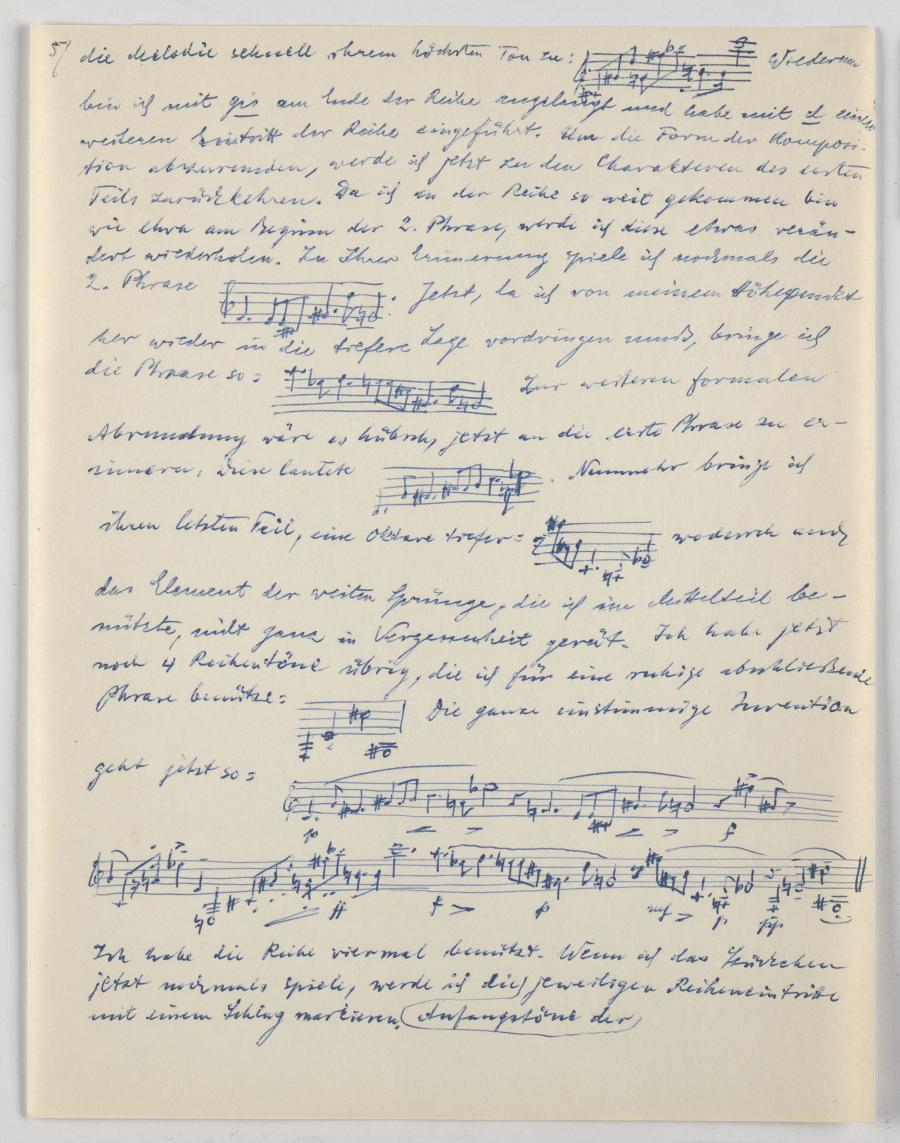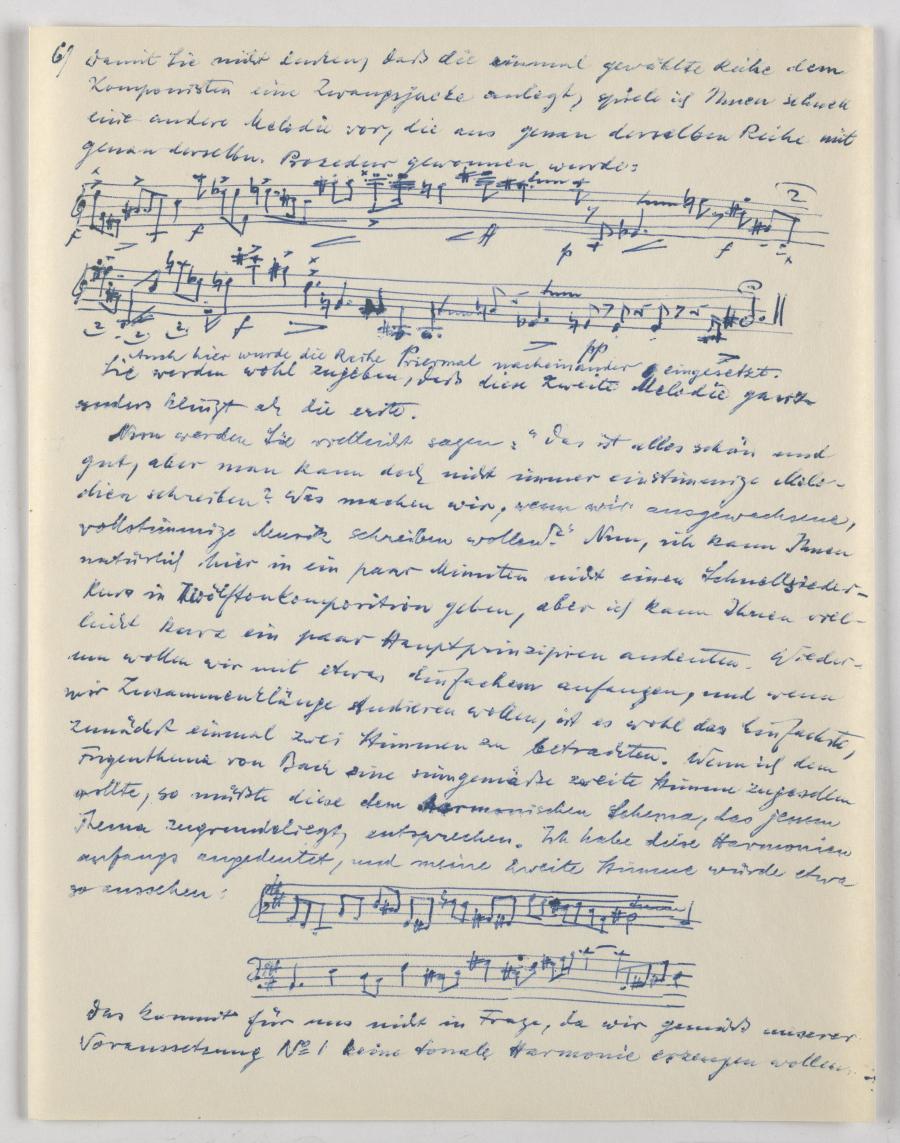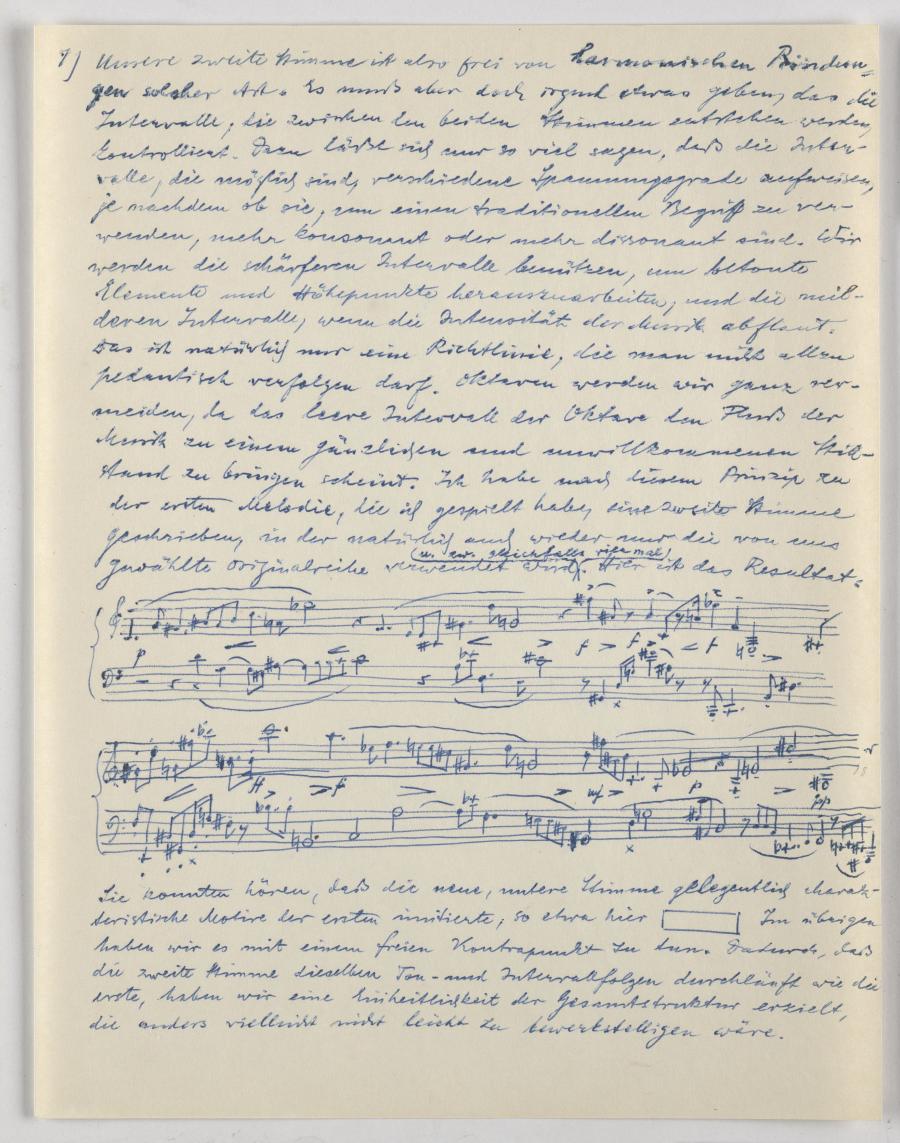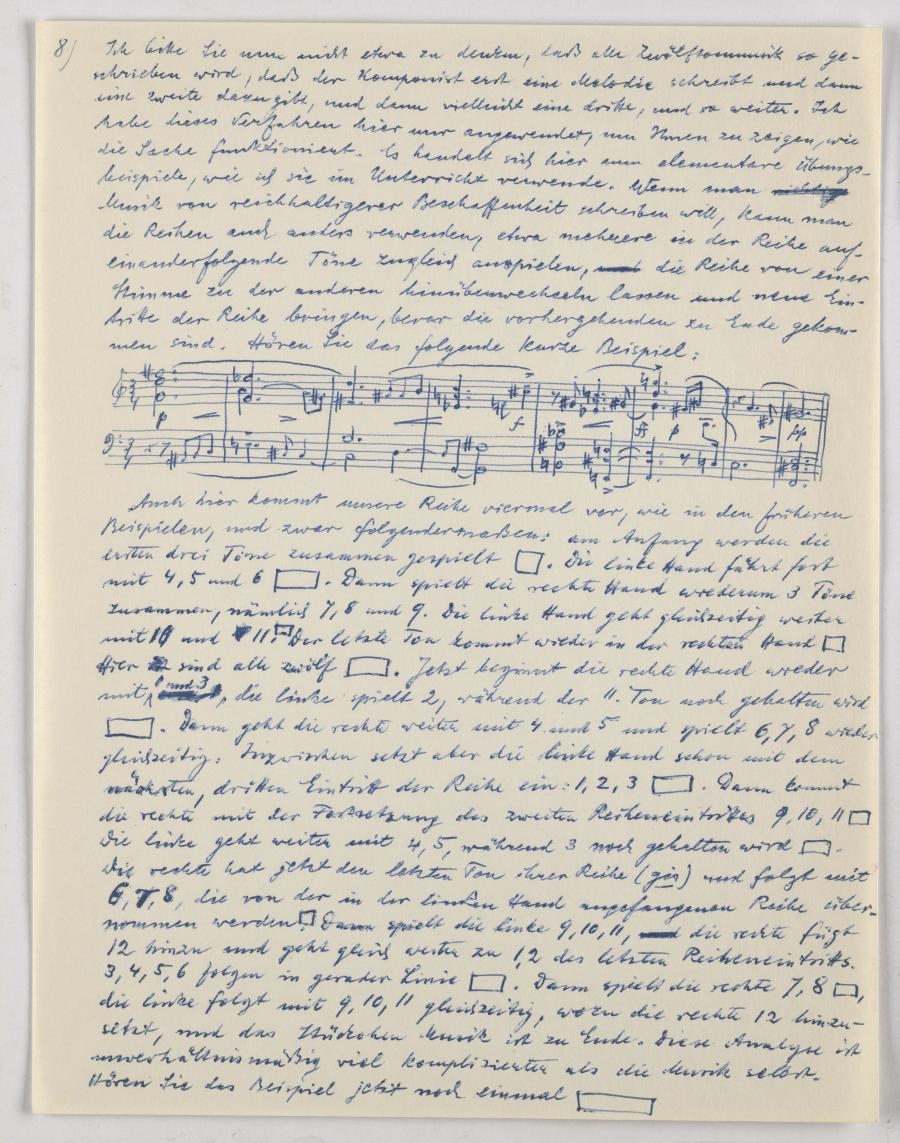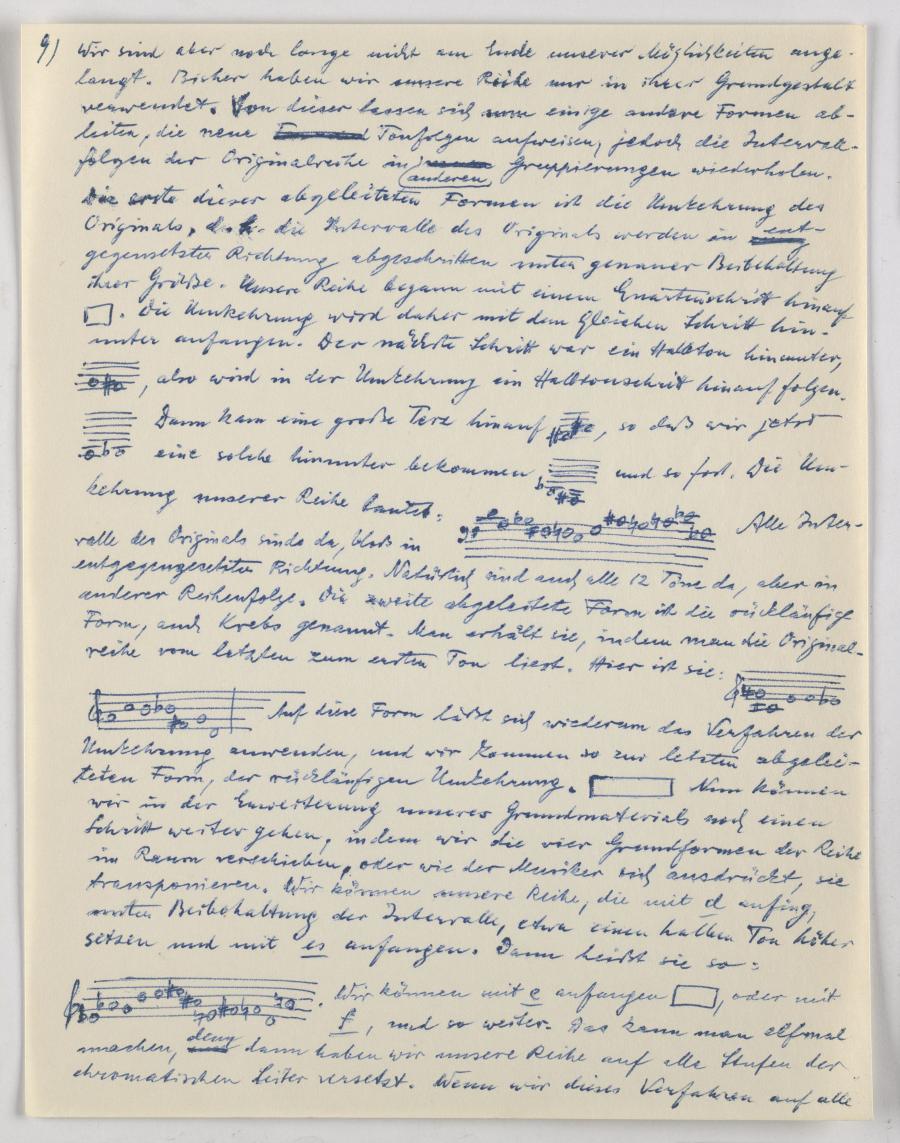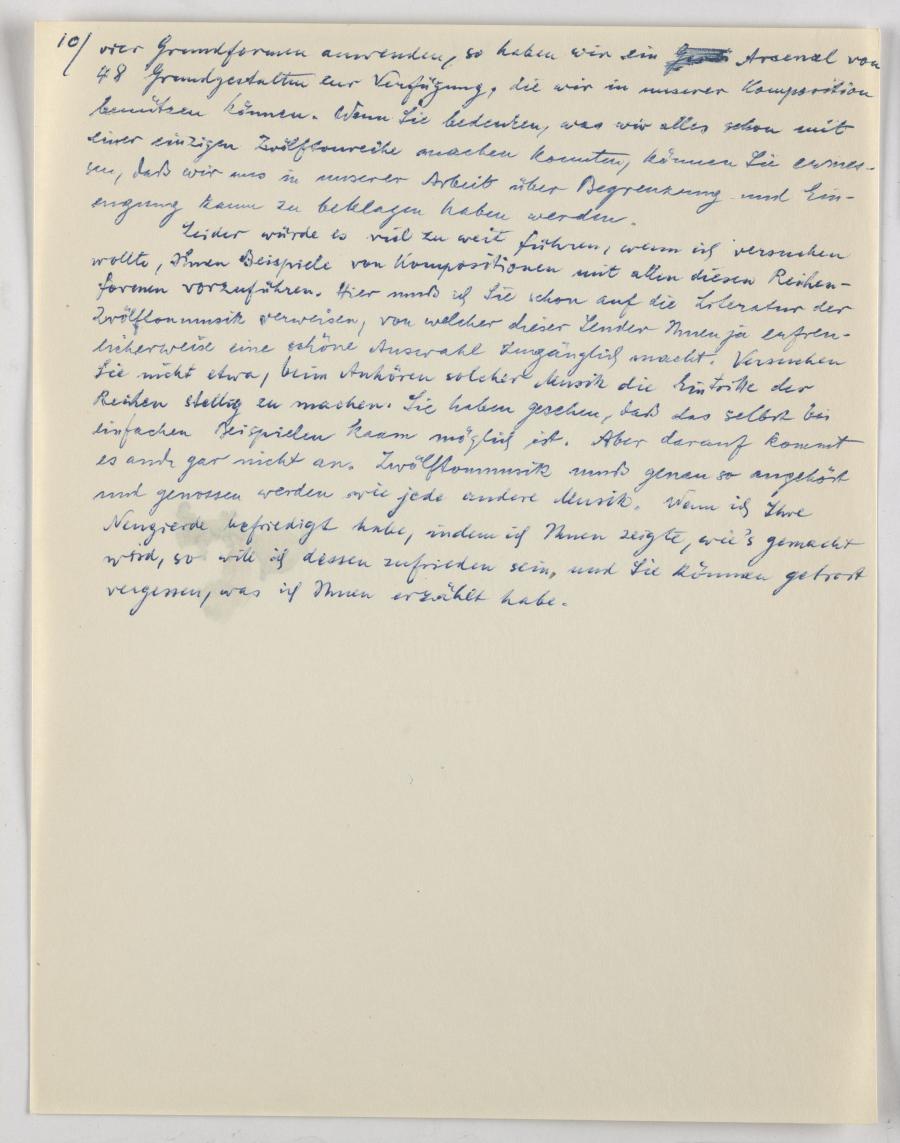Zwölftontechnik für Baden-Baden SWF
Abstract
Kreneks Vortrag zur Zwölftonmusik geht auf die praktischen Aspekte der Kompositionstechnik ein. Er beschreibt mit zahlreichen (vermutlich von ihm selbst am Klavier vorgetragenen) Beispielen welchen kreativen Spielraum Komponierende haben um mit unterschiedlichen Möglichkeiten die Zwölftonreihen zu manipulieren zu musikalisch interessanten Stücken kommen.
Der Vortrag wurde im September 1951 in Baden-Baden gehalten und im SWF übertragen, und stellt mit dem Fokus auf praktische Anwendung der Zwölftontechnik im Kompositionsprozess eine inhaltliche Ergänzung zu dem wenige Tage zuvor in Berlin gehaltenen Vortrag über das „Schicksal der Zwölftontechnik“. [vgl. LM 216]
lect
Über die Zwölftonmusik läßt sich von vielerlei Gesichts-
punkten diskutieren. Heute will ich sie einmal durchaus
von der Praxis her besprechen und Ihnen direkt demonstrie-
ren, wie man mit Zwölftonreihen komponiert. Zunächst
müssen wir uns darüber klar werden, wozu ein Komponist
überhaupt Zwölftonreihen braucht, um zu komponieren. Die
zwölf verschiedenen Töne, die wir innerhalb einer Oktave haben
12Ton Skala, sind schon seit undenklichen Zeiten bekannt und
sind in unserer Musik seit dem späteren 15. Jahrhundert kon-
stant verwendet worden. Die Zwölftontechnik hat also dem
Material der Musik nichts Neues hinzugefügt. Das Thema der 24.
Fuge im 1. Buch des ___
Die Zwölftonmusik, die wir heute betrachten wollen, unterscheidet sich
von der älteren Musik dadurch, daß sie nicht auf der tonalen
Harmonie beruht, d. h. daß die Akkorde, die Zusammenklänge, die
in ihr entstehen, nicht in jener Weise mit einander zusammen-
hängen wie die, die ich eben gespielt habe. Das ist die erste,
wesentliche Voraussetzung der Zwölftonmusik. Wer tonale Musik
schreiben will, wird keine Zwölftonreihen benützen. Man kann
das besser und leichter ohne
man die etwa bei
Wir wollen jetzt von allen philosophischen und historischen
Zusammenhängen absehen und uns anschauen, wie die Sache
praktisch aussieht. Wenn man unsere drei Voraussetzungen
gründlich durchdenkt, so ergibt sich, man sich
Jetzt wollen wir uns eine Zwölftonreihe aus den über
44 Millionen, die man zusammenstellen kann, aussuchen. Reihen,
in denen dasselbe Intervall allzuhäufig vonkommt, sind nicht
sehr praktisch, weil die Musik durch ständige Wiederholung
dieser Intervalle leicht monoton wird. Eine Reihe wie diese
Dieser Reihe ist noch kein musikalisches Thema. Sie ist nur eine
individuelle Anordnung des Materials, das wir benützen wollen,
nämlich der 12
Um zu zeigen, wie das gemacht wird, werden wir uns
zunächst eine ganz einfache Aufgabe stellen, und das
einfachste musikalische Problem ist wohl, eine melodische
Linie ohne jede Begleitung zu erfinden. Wie Sie wissen, gibt
es in der Literatur eine beträchtliche Anzahl solcher Stücke;
besonders
Jetzt bilde ich also eine melodische Phrase, in welcher die Töne unserer Reihe in der gegebenen Folge erscheinen.
4/
____. Die Töne, die ich dazu
benützen kann, sind mir allerdings vorgeschrieben. Ich habe
noch 4 übrig in der Originalreihe, und wenn ich mehr brau-
che, muß ich wieder von vorn anfangen. Hier ist meine 2.
Phrase: ____ Da ich
mein kleines, einstimmiges Stück nicht zu lang machen will, ist
es jetzt vielleicht Zeit für einen kontrastierenden Abschnitt.
Da bisher die melodische Bewegung hauptsächlich in en-
gen Intervallen vor sich ging, wollen wir jetzt Sprünge be-
tonen. Durch die früher besprochene Oktavenversetzung
läßt sich leicht jedes enge Intervall der Reihe in ein weites
verwandeln, z. B. wenn ich in der Originalreihe ausge
die Melodie schnell ihrem höchsten Ton zu: gis am Ende der Reihe angelangt und habe mit d einen
weiteren Eintritt der Reihe eingeführt. Um die Form der Komposi-
tion abzurunden, werde ich jetzt zu den Charakteren des ersten
Teils zurückkehren. Da ich in der Reihe so weit gekommen bin
wie etwa am Beginn der 2. Phrase, werde ich diese etwas verän-
dert wiederholen. Zu Ihrer Erinnerung spiele ich nochmals die
2. Phrase
Damit sie nicht denken, daß die einmal gewählte Reihe dem
Komponisten eine Zwangsjacke anlegt, spiele ich Ihnen schnell
eine andere Melodie vor, die aus genau derselben Reihe mit
genau derselbe. Prozedur gewonnen wurde:
eingesetzt.
Nun werden Sie vielleicht sagen, "Das ist alles schön und
gut, aber man kann doch nicht immer einstimmige Melo-
dien schreiben? Was machen wir, wenn wir ausgewachsene,
vollstimmige Musik schreiben wollen?" Nun, ich kann Ihnen
natürlich hier in ein paar Minuten nicht einen Schnellsieder-
kurs in Zwölftonkomposition geben, aber ich kann Ihnen viel-
leicht kurz ein paar Hauptprinzipien andeuten. Wieder-
um wollen wir mit etwas Einfachem anfangen, und wenn
wir Zusammenklänge studieren wollen, ist es wohl das Einfachste,
zunächst einmal zwei Stimmen zu betrachten. Wenn ich dem
Fugenthema von
Das kommt für uns nicht in Frage, da wir gemäß unserer Voraussetzung No. 1 keine tonale Harmonie erzeugen wollen.
7/
Unsere zweite Stimme ist also frei von harmonischen Bindun-
gen solcher Art. Es muß aber doch irgend etwas geben, das die
Intervalle, die zwischen den beiden Stimmen entstehen werden,
kontrolliert. Dazu läßt sich nur so viel sagen, daß die Inter-
valle, die möglich sind, verschiedene Spannungsgrade aufweisen,
je nachdem ob sie, um einen traditionellen Begriff zu ver-
wenden, mehr konsonant oder mehr dissonant sind. Wir
werden die schärferen Intervalle benützen, um betonte
Elemente und Höhepunkte herauszuarbeiten, und die mil-
deren Intervalle, wenn die Intensität der Musik abflaut.
Das ist natürlich nur eine Richtlinie, die man nicht allzu
pedantisch verfolgen darf. Oktaven werden wir ganz ver-
meiden, da das leere Intervall der Oktave den Fluß der
Musik zu einem gänzlichen und unwillkommenen Still-
stand zu bringen scheint. Ich habe nach diesem Prinzip zu
der ersten Melodie, die ich gespielt habe, eine zweite Stimme
geschrieben, in der natürlich auch wieder nur die von uns
gewählte Originalreihe
Sie konnten hören, daß die neue, untere Stimme gelegentlich charak-
teristische Motive der ersten imitierte, so etwa hier ____ Im übrigen
haben wir es mit einem freien Kontrapunkt zu tun. Dadurch, daß
die zweite Stimme dieselben Ton- und Intervallfolgen durchläuft wie die
erste, haben wir eine Einheitlichkeit der Gesamtstruktur erzielt,
die anders vielleicht nicht leicht zu bewerkstelligen wäre.
Ich bitte Sie nun nicht etwa zu denken, daß alle Zwölftonmusik so ge-
schrieben wird, daß der Komponist erst eine Melodie schreibt und dann
eine zweite dazu gibt, und dann vielleicht eine dritte, und so weiter. Ich
habe dieses Verfahren hier nur angewendet, um Ihnen zu zeigen, wie
die Sache funktioniert. Es handelt sich hier um elementare Übungs-
beispiele, wie ich sie im Unterricht verwende. Wenn man
Auch hier kommt unsere Reihe viermal vor, wie in den früheren
Beispielen, und zwar folgendermaßen: am Anfang werden die
ersten drei Töne zusammen gespielt __ . Die linke Hand führt fort
mit 4, 5 und 6 ___. Dann spielt die rechte Hand wiederum 3 Töne
zusammen, nämlich 7, 8 und 9. Die linke Hand geht gleichzeitig weiter
mit 10 und __
Hier ___. Jetzt beginnt die rechte Hand wieder
, die___. Dann geht die rechte weiter mit 4 und 5 und spielt 6, 7, 8 wieder
gleichzeitig. Inzwischen setzt aber die linke Hand schon mit dem
nächsten, dritten Eintritt der Reihe ein: 1, 2, 3 ___. Dann kommt
die rechte mit der Fortsetzung des zweiten Reiheneintrittes 9, 10, 11 __
Die linke geht weiter mit 4, 5, während 3 noch gehalten wird __
Die rechte hat jetzt den letzten Ton ihrer Reihe (gis) und folgt mit
6, 7, 8, die von der in der linken Hand angefangenen Reihe über-
nommen werden __. Dann spielt die linke 9, 10, 11, __. Dann spielt die rechte 7, 8 __,
die linke folgt mit 9, 10, 11 gleichzeitig, wozu die rechte 12 hinzu-
setzt, und das Stückchen Musik ist zu Ende. Diese Analyse ist
unverhältnismäßig viel komplizierter als die Musik selbst.
Hören Sie das Beispiel jetzt noch einmal ____
Wir sind aber noch lange nicht am Ende unserer Möglichkeiten ange-
langt. Bisher haben wir unsere Reihe nur in ihrer Grundgestalt
verwendet. Von dieser lassen sich nun einige andere Formen ab-
leiten, die neue neuen Gruppierungen __ . Die Umkehrung wird daher mit dem gleichen Schritt hin-
unter anfangen. Der nächste Schritt war ein Halbton hinunter,
____ Nun können
wir in der Erweiterung unseres Grundmaterials noch einen
Schritt weiter gehen, indem wir die vier Grundformen der Reihe
im Raum verschieben, oder wie der Musiker sich ausdrückt, sie
transponieren. Wir können unsere Reihe, die mit d anfing,
unten Beibehaltung der Intervalle, etwa einen halben Ton höher
setzen und mit es anfangen. Dann heißt sie so:
e anfangen ___, oder mit
f, und so weiter. Das kann man elfmal
vier Grundformen anwenden, so haben wir ein
Leider würde es viel zu weit führen, wenn ich versuchen wollte, Ihnen Beispiele von Kompositionen mit allen diesen Reihen- formen vorzuführen. Hier muß ich Sie schon auf die Literatur der Zwölftonmusik verweisen, von welcher dieser Sender Ihnen ja erfreu- licherweise eine schöne Auswahl zugänglich macht. Versuchen Sie nicht etwa, beim Anhören solcher Musik die Eintritte der Reihen stellig zu machen. Sie haben gesehen, daß das selbst bei einfachen Beispielen kaum möglich ist. Aber darauf kommt, es auch gar nicht an. Zwölftonmusik muß genau so angehört und genossen werden wie jede andere Musik. Wenn ich Ihre Neugierde befriedigt habe, indem ich Ihnen zeigte, wie's gemacht wird, so will ich dessen zufrieden sein, und Sie können getrost vergessen, was ich Ihnen erzählt habe.