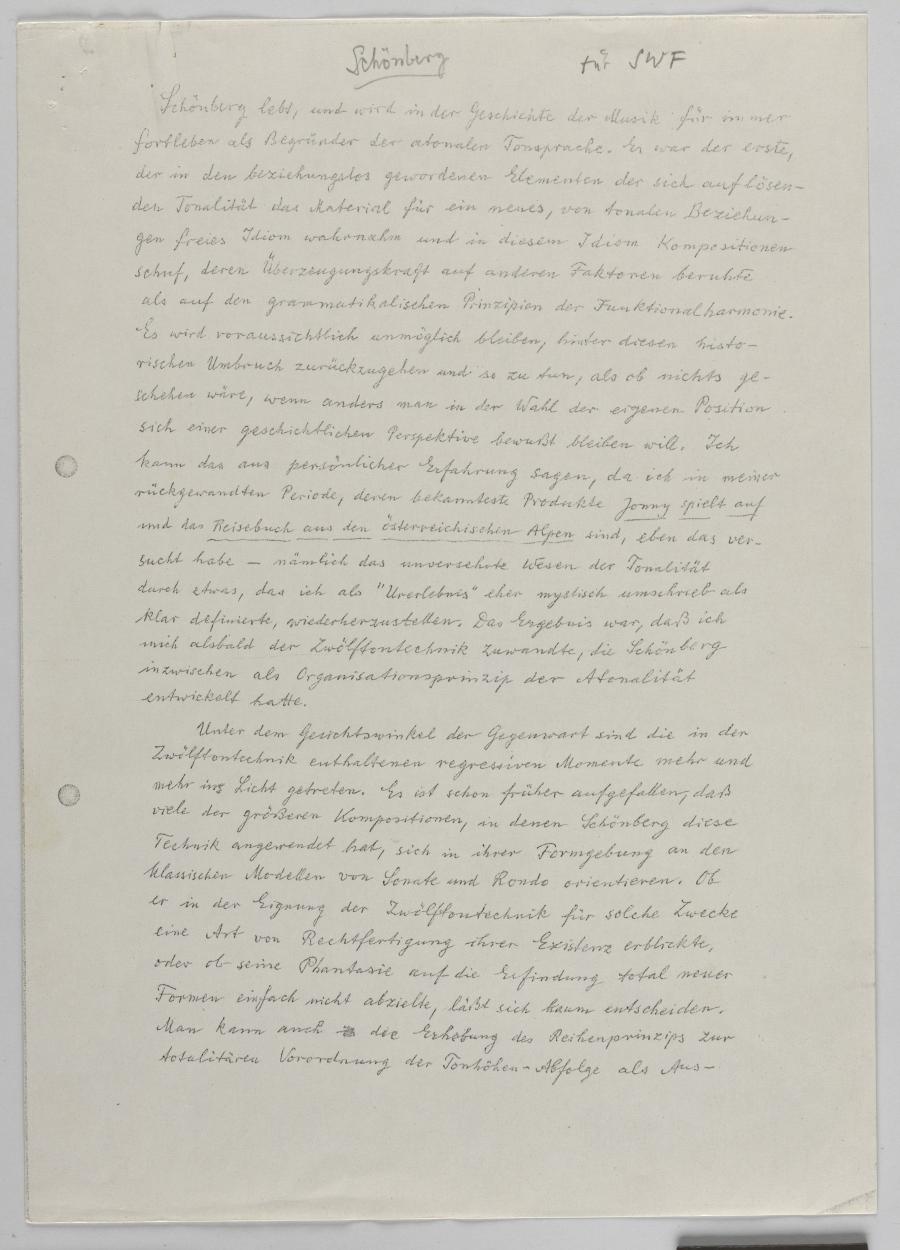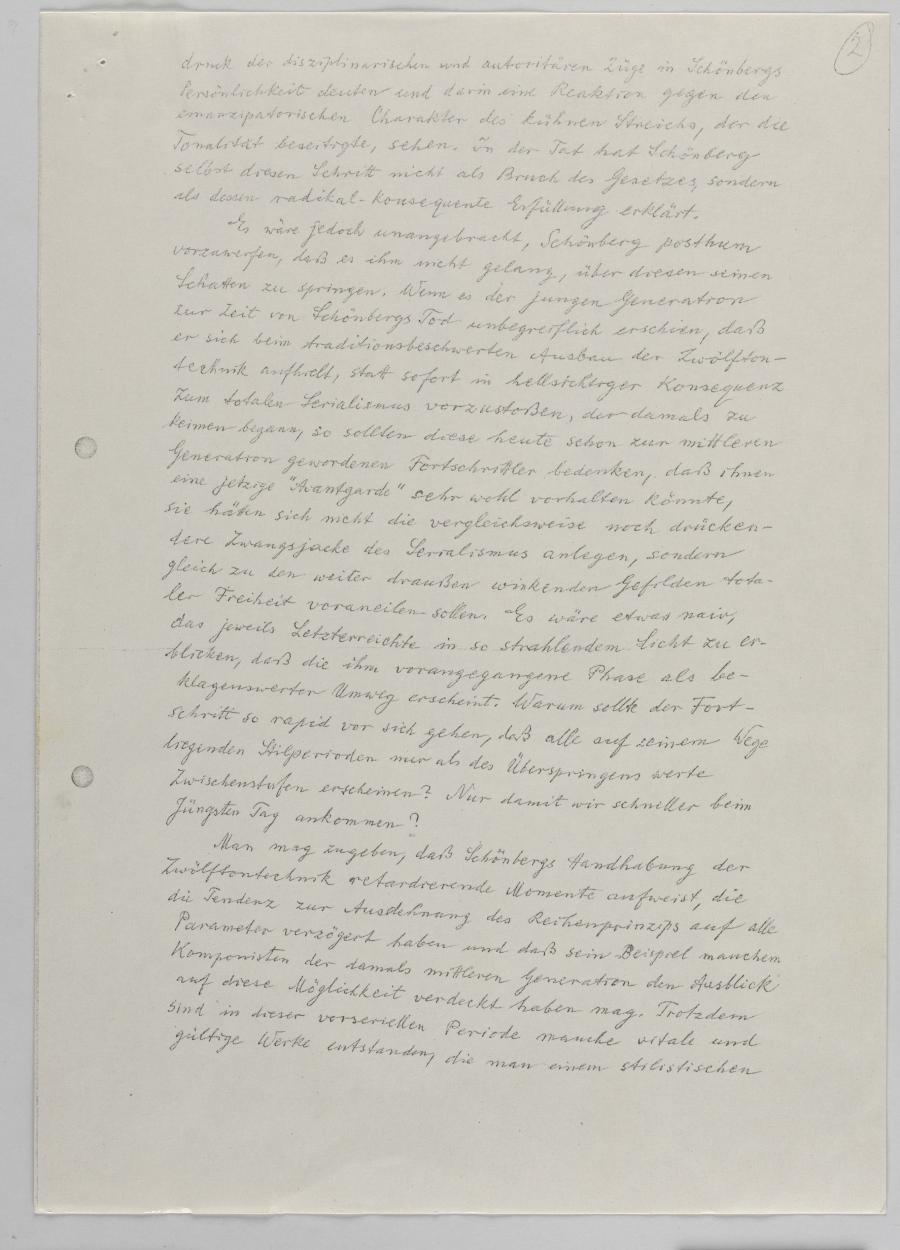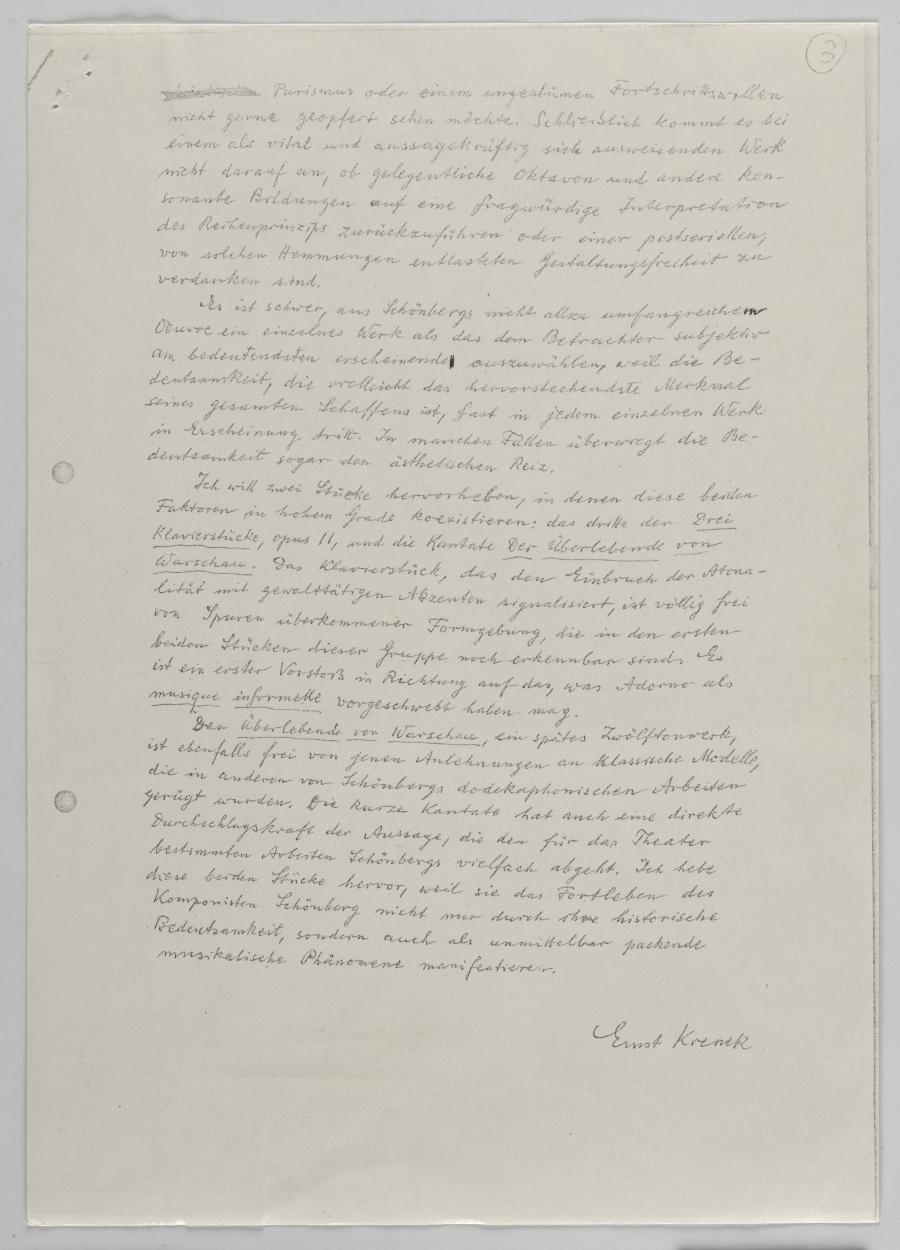Schönberg
für SWF
Schönberg lebt, und wird in der Geschichte der Musik für immer
fortleben als Begründer der atonalen Tonsprache. Er war der erste,
der in den beziehungslos gewordenen Elementen der sich auflösen-
den Tonalität das Material für ein neues, von tonalen Beziehun-
gen freies Idiom wahrnahm und in diesem Idiom Kompositionen
schuf, deren Überzeugungskraft auf anderen Faktoren beruhte
als auf den grammatikalischen Prinzipien der Funktionalharmonie.
Es wird voraussichtlich unmöglich bleiben, hinter diesen histo-
rischen Umbruch zurückzugehen und so zu tun, als ob nichts ge-
schehen wäre, wenn anders man in der Wahl der eigenen Position
sich einer geschichtlichen Perspektive bewußt bleiben will. Ich
kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, da ich in meiner
rückgewandten Periode, deren bekannteste Produkte Jonny spielt auf
und das Reisebuch aus den österreichischen Alpen
Unter dem Gesichtswinkel der Gegenwart sind die in der
Zwölftontechnik enthaltenen regressiven Momente mehr und
mehr ins Licht getreten. Es ist schon früher aufgefallen, daß
viele der größeren Kompositionen, in denen Schönberg diese
Technik angewendet hat, sich in ihrer Formgebung an den
klassischen Modellen von Sonate und Rondo orientieren. Ob
er in der Eignung der Zwölftontechnik für solche Zwecke
eine Art von Rechtfertigung ihrer Existenz erblickte,
oder ob seine Phantasie auf die Erfindung total neuer
Formen einfach nicht abzielte, läßt sich kaum entscheiden.
Man kann auch
2
druck der disziplinarischen und autoritären Züge in Schönbergs
Persönlichkeit deuten und darin eine Reaktion gegen den
emanzipatorischen Charakter des kühnen Streichs, der die
Tonalität beseitigte, sehen. In der Tat hat Schönberg
selbst diesen Schritt nicht als Bruch des Gesetzes, sondern
als dessen radikal-konsequente Erfüllung erklärt.
Es wäre jedoch unangebracht, Schönberg posthum
vorzuwerfen, daß er ihm nicht gelang, über diesen seinen
Schatten zu springen. Wenn es der jungen Generation
zur Zeit von Schönbergs Tod unbegreiflich erschien, daß
er sich beim traditionsbeschwerten Ausbau der Zwölfton-
technik aufhielt, statt sofort in hellsichtiger Konsequenz
zum totalen Serialismus vorzustoßen, der damals zu
keimen begann, so sollten diese heute schon zur mittleren
Generation gewordenen Fortschrittler bedenken, daß ihnen
eine jetzige "Avantgarde" sehr wohl vorhalten könnte,
sie hätten sich nicht die vergleichsweise noch drücken-
dere Zwangsjacke des Serralismus anlegen, sondern
gleich zu den weiter draußen winkenden Gefilden tota-
ler Freiheit voraneilen sollen. Es wäre etwas naiv,
das jeweils Letzterreichte in so strahlendem Licht zu er-
blicken, daß die ihm vorangegangene Phase als be-
klagenswerter Umweg erscheint. Warum sollte der Fort-
schritt so rapid vor sich gehen, daß alle auf seinem Wege
liegenden Stilperioden nur als des Überspringens werte
Zwischenstufen erscheinen? Nur damit wir schneller beim
Jüngsten Tag ankommen?
Man mag zugeben, daß Schönbergs Handhabung der
Zwölftontechnik retardierende Momente aufweist, die
die Tendenz zur Ausdehnung des Reihenprinzips auf alle
Parameter verzögert haben und daß sein Beispiel manchem
Komponisten der damals mittleren Generation den Ausblick
auf diese Möglichkeit verdeckt haben mag. Trotzdem
sind in dieser vorseriellen Periode manche vitale und
gültige Werke entstanden, die man einem stilistischen
3
Es ist schwer, aus Schönbergs nicht allzu umfangreichem
Oeuvre ein einzelnes Werk als das dem Betrachter subjektiv
am bedeutendsten erscheinendes auszuwählen, weil die Be-
deutsamkeit, die vielleicht das hervorstechendste Merkmal
seines gesamten Schaffens ist, fast in jedem einzelnen Werk
in Erscheinung tritt. In manchen Fällen überwiegt die Be-
deutsamkeit sogar den ästhetischen Reiz.
Ich will zwei Stücke hervorheben, in denen diese beiden
Faktoren in hohem Grade koexistieren: das dritte der Drei
Klavierstücke, opus 11, und die Kantate Der Überlebende von
Warschau. Das Klavierstück, das den Einbruch der Atona-
lität mit gewalttätigen Akzenten signalisiert, ist völlig frei
von Spuren überkommener Formgebung, die in den ersten
beiden Stücken dieser Gruppe noch erkennbar sind: Es
ist ein erster Vorstoß in Richtung auf das, was Adorno als
musique informelle vorgeschwebt haben mag.
Der Überlebende von Warschau, ein spätes Zwölftonwerk,
ist ebenfalls frei von jenen Anlehnungen an klassische Modelle,
die in anderen von Schönbergs dodekaphonischen Arbeiten
gerügt wurden. Die kurze Kantate hat auch eine direkte
Durchschlagskraft der Aussage, die den für das Theater
bestimmten Arbeiten Schönbergs vielfach abgeht. Ich hebe
diese beiden Stücke hervor, weil sie das Fortleben des
Komponisten Schönberg nicht nur durch ihre historische
Bedeutsamkeit, sondern auch als unmittelbar packende
musikalische Phänomene manifestieren.
Ernst Krenek