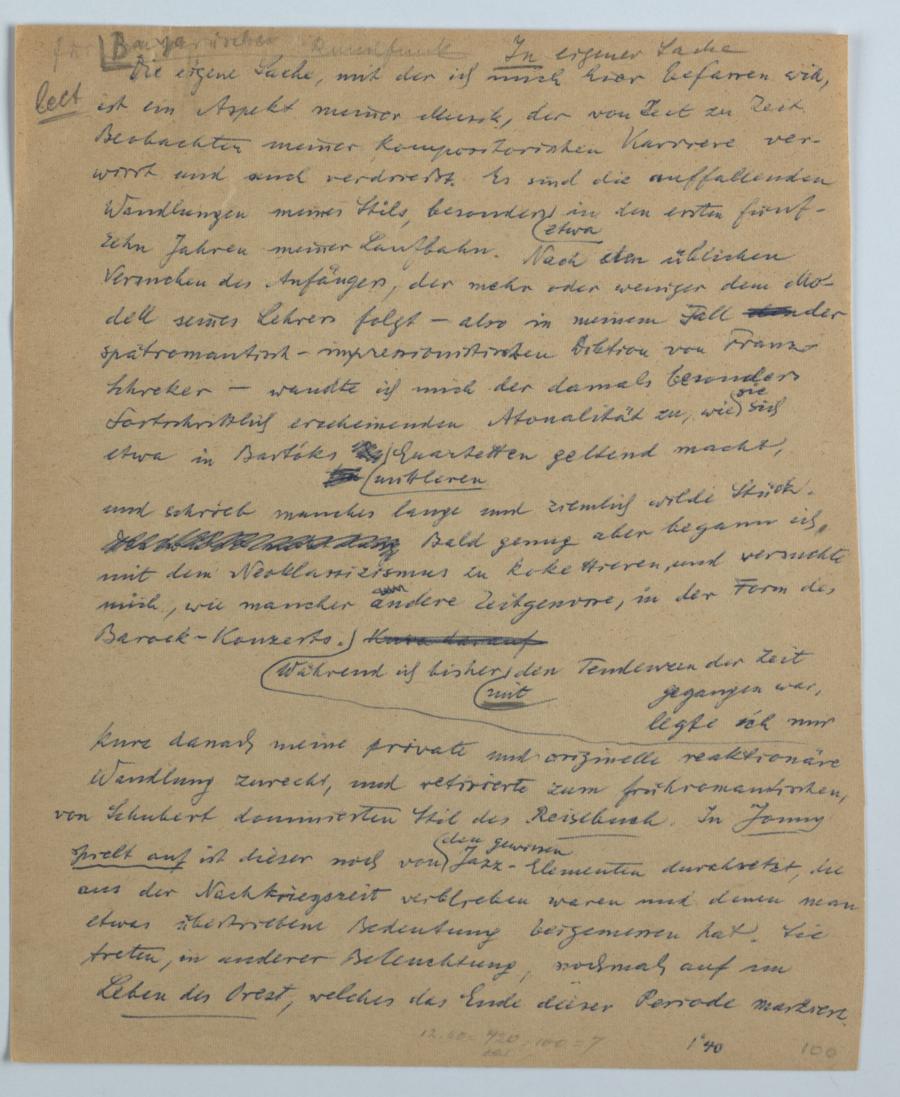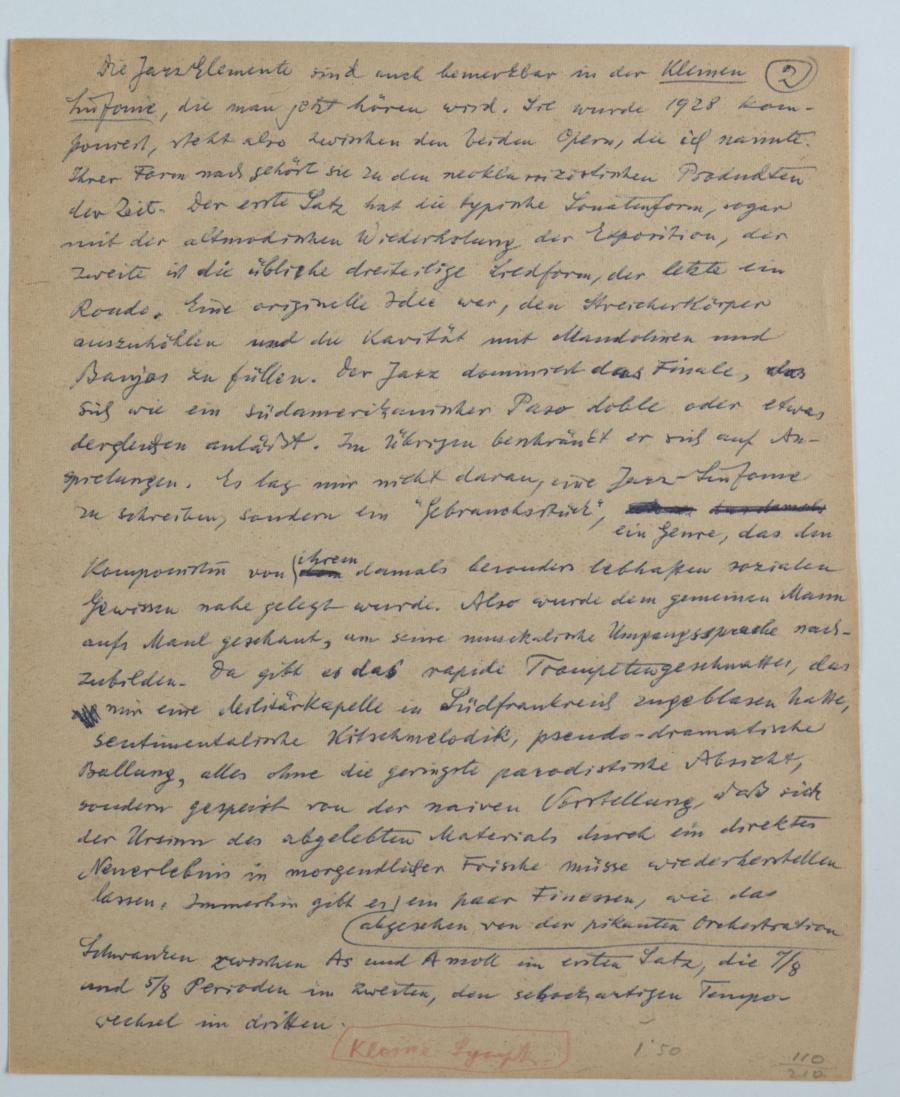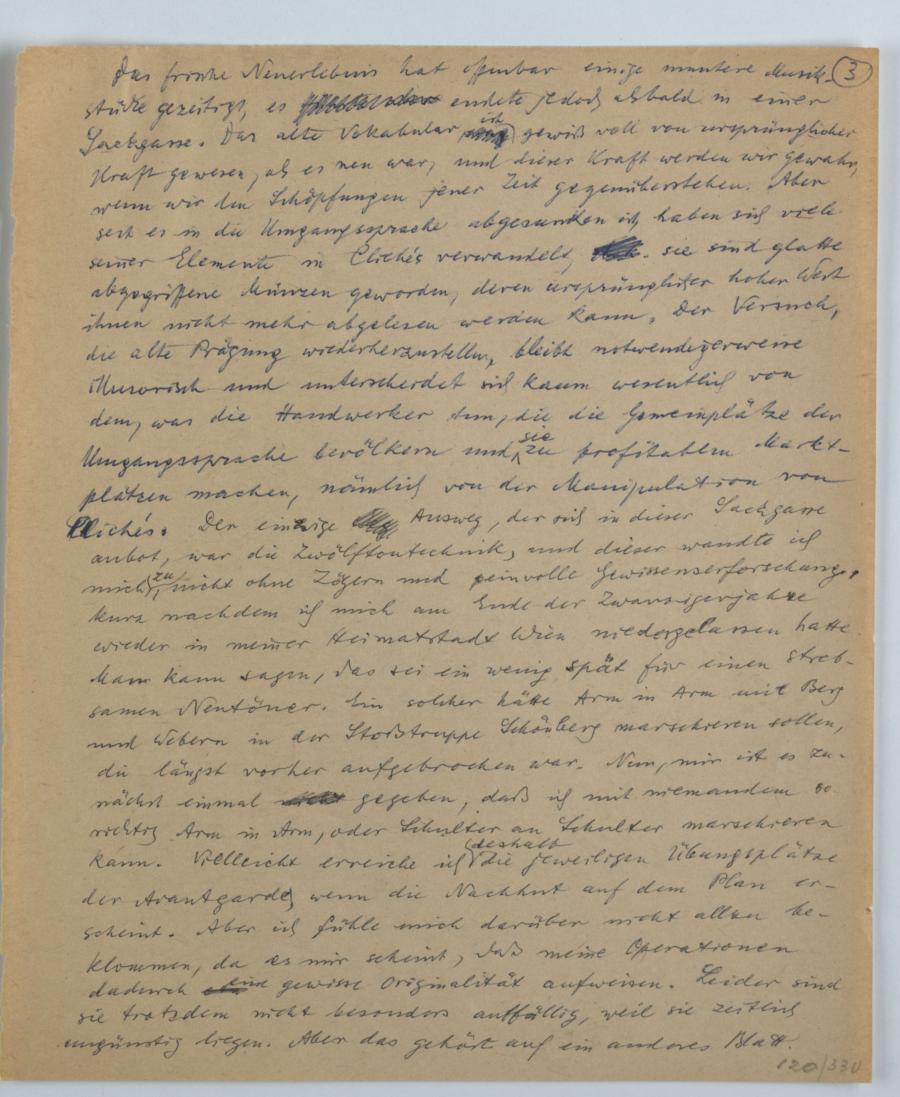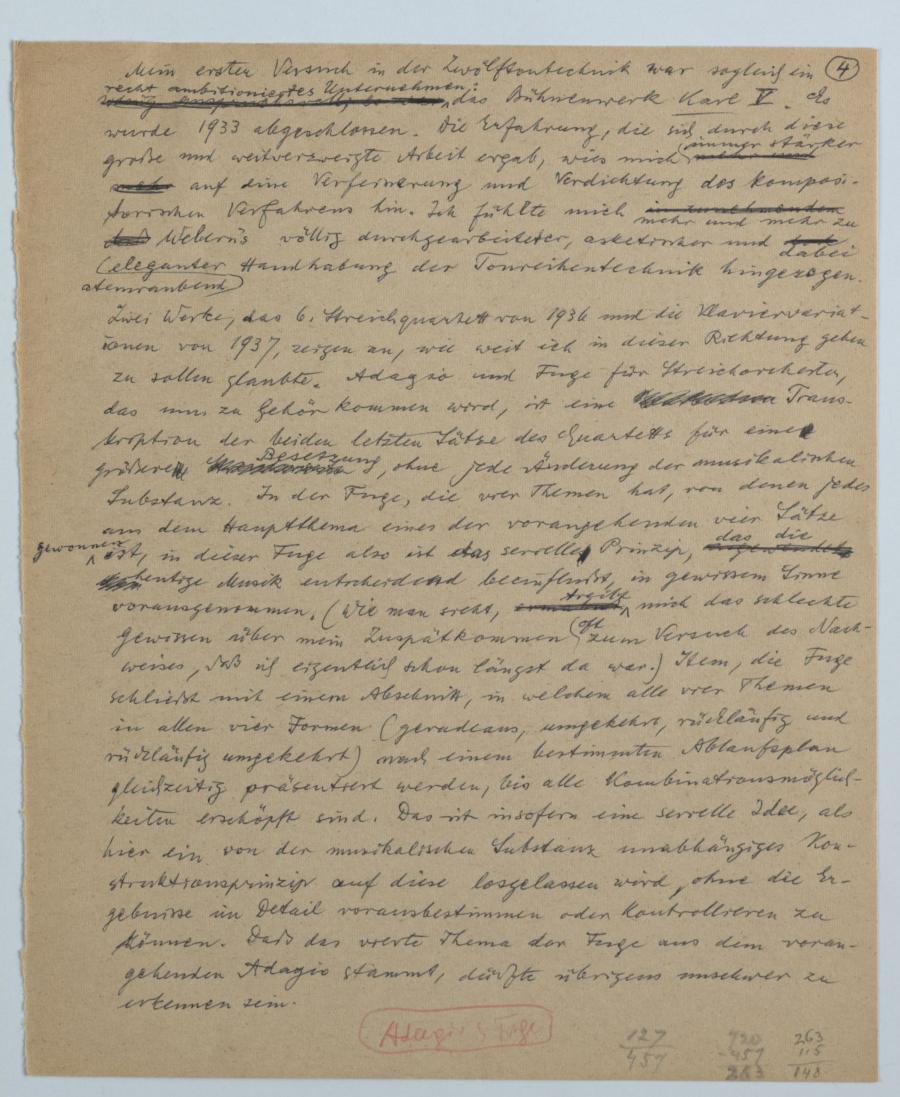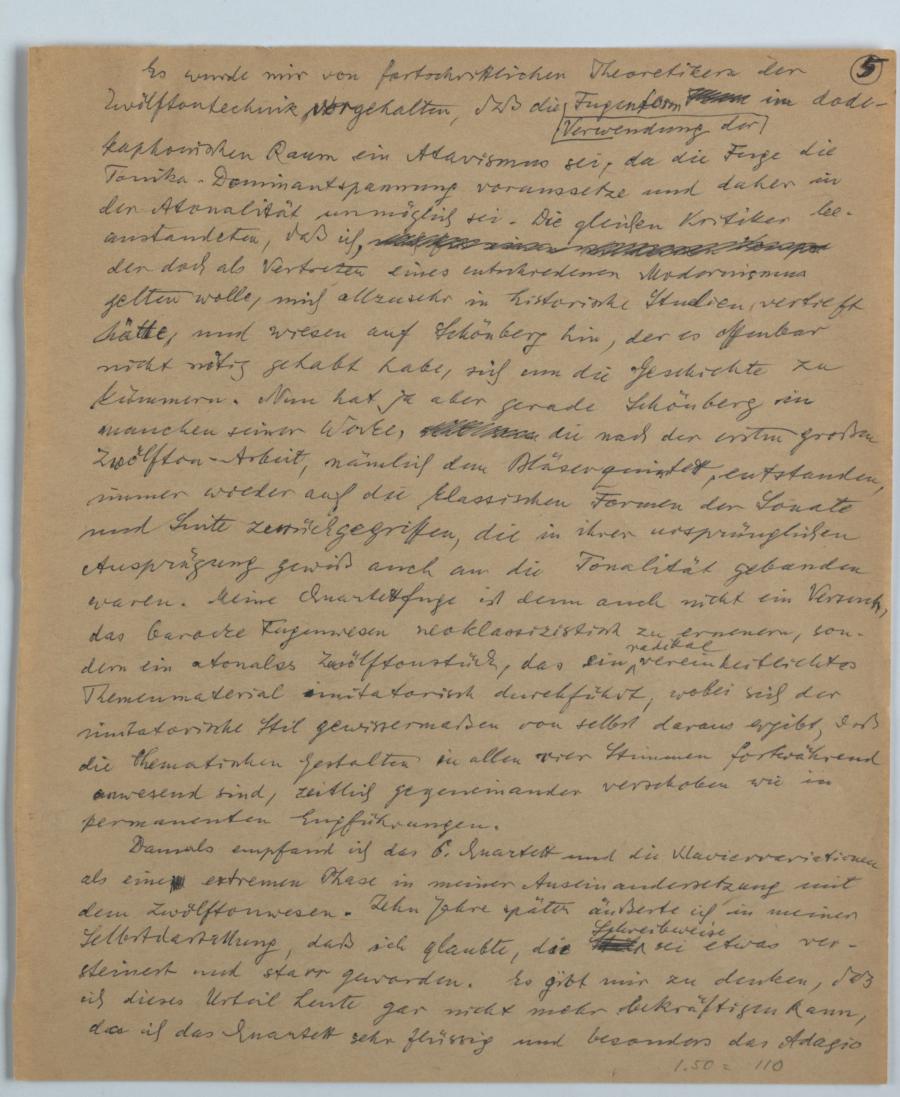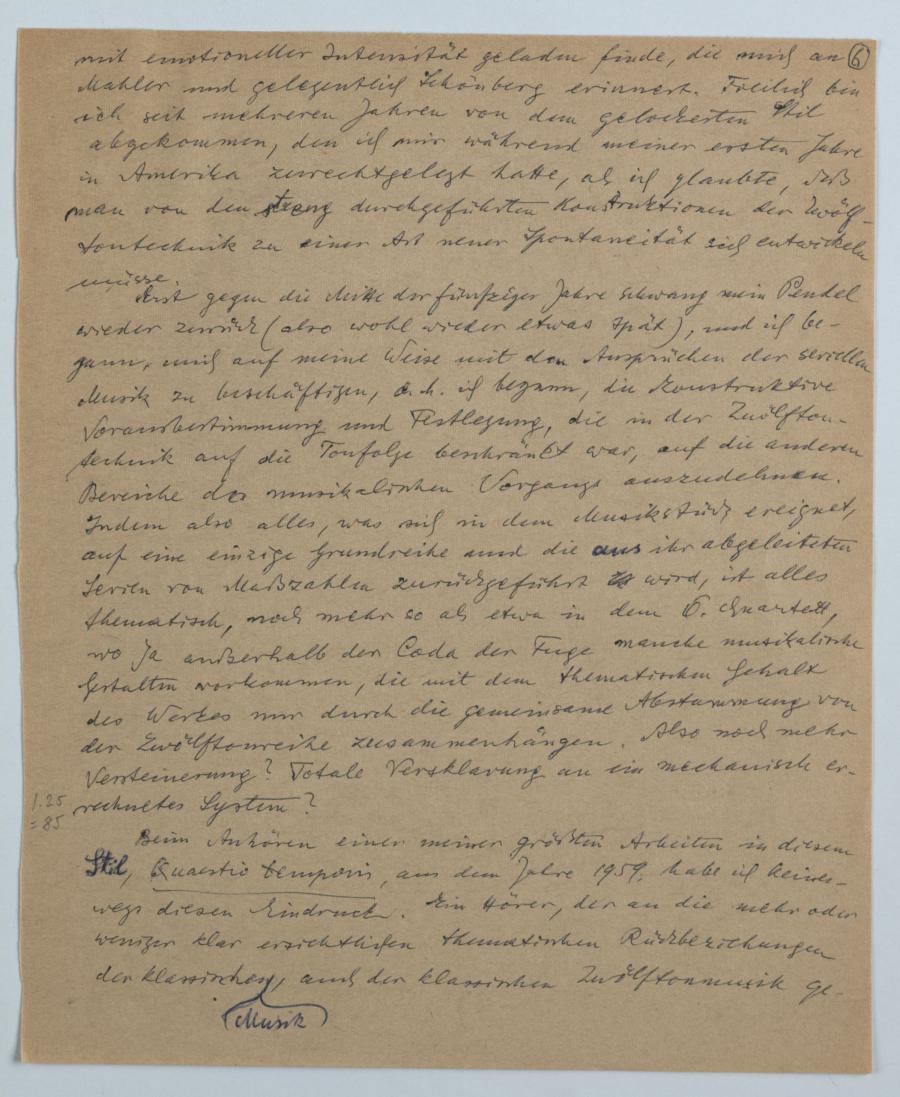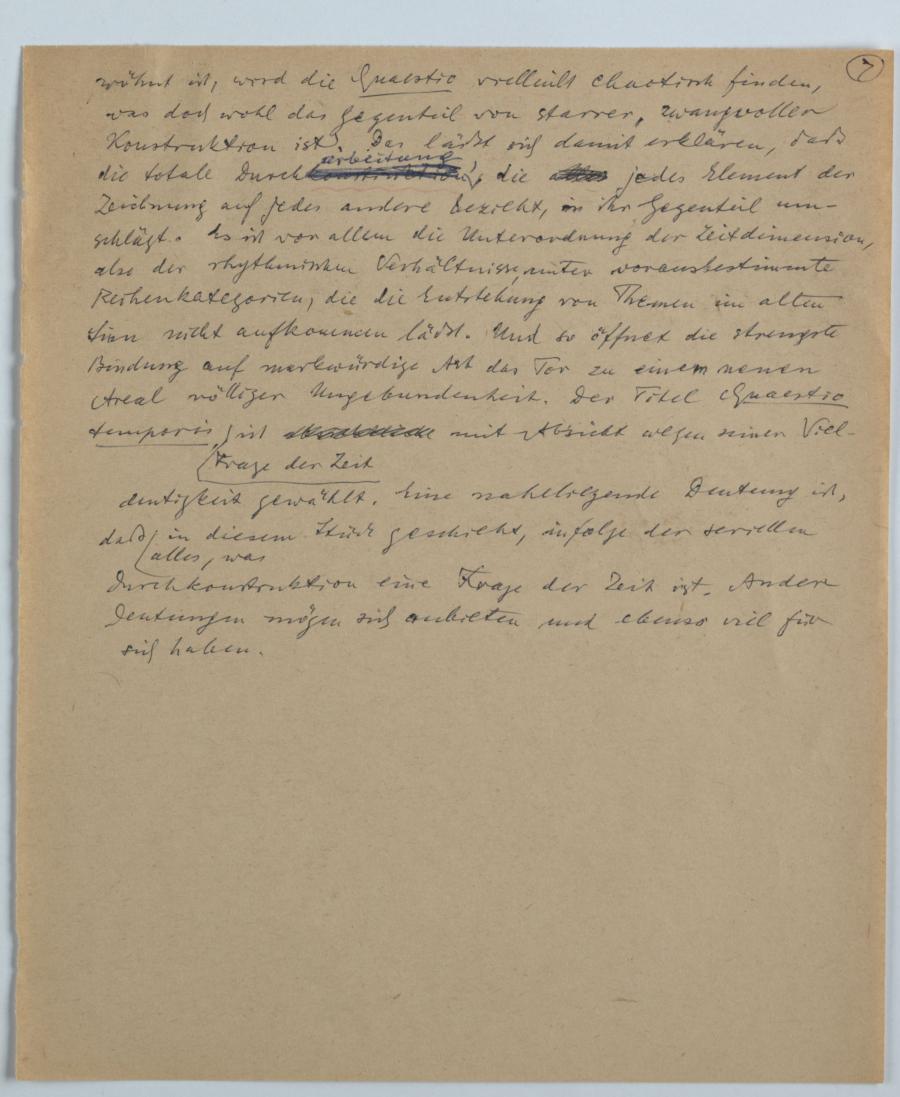In eigener Sache
Abstract
Für eine Radiosendung im Bayerischen Rundfunk 1962 vergleicht Krenek drei seiner an unterschiedlichen Punkten seiner Karriere entstandene Werke: Kleine Symphonie, op. 58 (1928), Adagio und Fuge, op. 78a (1936) und Quaestio Temporis, op. 170 (1959).
Eingebettet in eine analytische Selbstbetrachtung zur Frage nach den häufigen Stilwechseln in seiner kompositorischen Entwicklung, bespricht Krenek seine neoromantische, mit Jazz-Elementen spielende Phase rund um Jonny spielt auf und die Kleine Symphonie, seinen Schritt zur Zwölftonkomposition mit der Oper Karl V und dem 6. Streichquartett (aus dem Adagio und Fuge stammt) und schließlich seiner jüngsten Beschäftigung mit seriellen Techniken, die in Quaestio Temporis angewendet wurden.
Bayerischer Rundfunk
Ineigener Sache
lect
Die eigene Sache, mit der ich mich hier befassen will,
ist ein Aspekt meiner Musik, der von Zeit zu Zeit
Beobachter meiner kompositorischen Karriere ver-
wirrt und auch verdrießt. Es sind die auffallenden
Wandlungen meiner Stils, 2 fin mittlerenKurz darauf Reisebuch. In
Jonny
ist dieser nochspielt auf
, welches das Ende dieser Periode markiert.Leben des Orest
2
Die Jazz-Emente sind auch bemerkbar in der Sinfonie, die man jetzt hören wird. Sie wurde 1928 kom-
poniert, steht also zwischen den beiden Opern, die ich nannte.
Ihrer Form nach gehört sie zu den neoklassizistischen Produkten
der Zeit. Der erste Satz hat die typische Sonatenform, sogar
mit der altmodischen Wiederholung der Exposition, der
zweite ist die übliche dreiteilige Liedform, der letzte ein
Rondo. Eine originelle Idee war, den Streicherkörper
auszuhöhlen und die Kavität mit Mandolinen und
Banjos zu füllen. Der Jazz dominiert das Finale, das
sich wie ein südamerikanischer Paso doble oder etwas
dergleichen anläßt. Im Übrigen beschränkt er sich auf An-
spielungen. Es lag mir nicht daran, eine Jazz-Sinfonie
zu schreiben, sondern ein "Gebrauchsstück",
Kleine Symph.
3
Das frische Neuerlebnis hat offenbar einige muntere Musik-
stücke gezeitigt, es war etw
4
Mein ersten Versuch in der Zwölftontechnik war sogleich ein
wenig anspruchsvoll; es war Karl Vmehr undin zunehmenden doch nn Streichersatz s Prinzip, angewendet ermahnt
5
Es wurde mir von fortschrittlichen Theoretikern der
Zwölftontechnik vorgehalten, daß Form im
Damals empfand ich das nStil
6
mit emotioneller Intensität geladen finde, die mich an
Erst gegen die Mitte der fünfziger Jahre schwang mein Pendel
wieder zurück (also wohl wieder etwas spät), und ich be-
gann, mich auf meine Weise mit den Ansprüchen der seriellen
Musik zu beschäftigen, d.h. ich begann, die konstruktive
Vorausbestimmung und Festlegung, die in der Zwölfton-
technik auf die Tonfolge beschränkt war, auf die anderen
Bereiche des musikalischen Vorgangs auszudehnen.
Indem also alles, was sich in dem Musikstück ereignet,
auf eine einzige Grundreihe und die aus ihr abgeleiteten
Serien von Maßzahlen zurückgeführt
Beim Anhören einer meiner größten Arbeiten in diesem
Stil, Quaestio temporis, aus dem Jahre 1959, habe ich keines-
wegs diesen Eindruck. Ein Hörer, der an die mehr oder
weniger klar ersichtlichen thematischen Rückbeziehungen
der
7
wöhnt ist, wird die Quaestio vielleicht chaotisch finden,
was doch wohl das Gegenteil von starrer, zwangvoller
Konstruktion ist. Das läßt sich damit erklären, daß
die totale Durch
Quaestio
,temporis