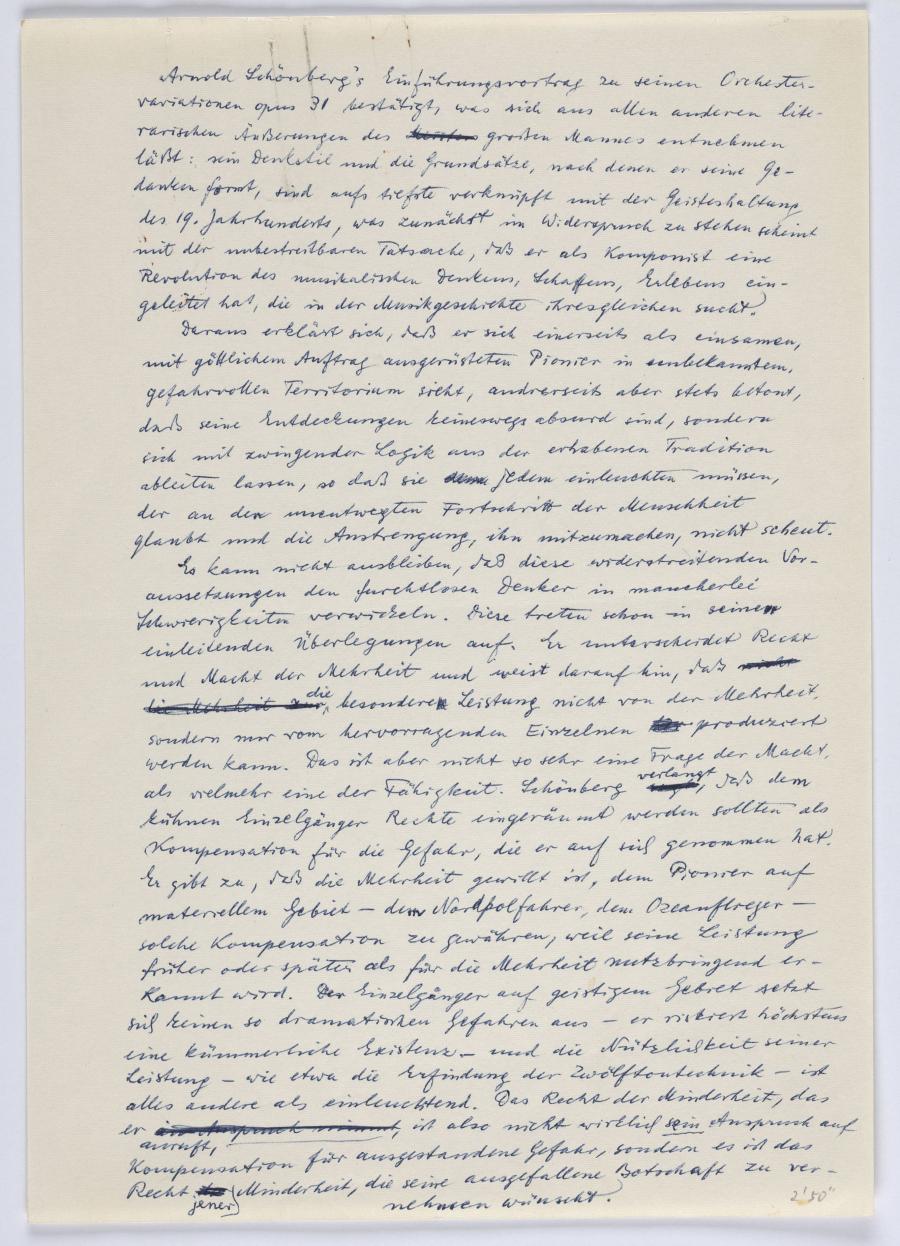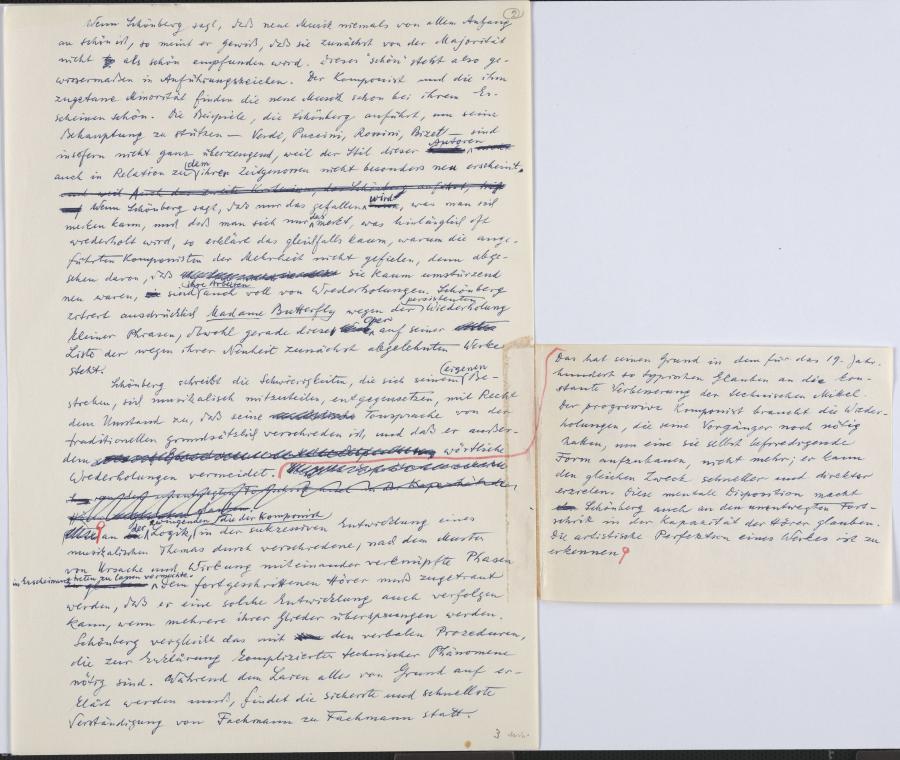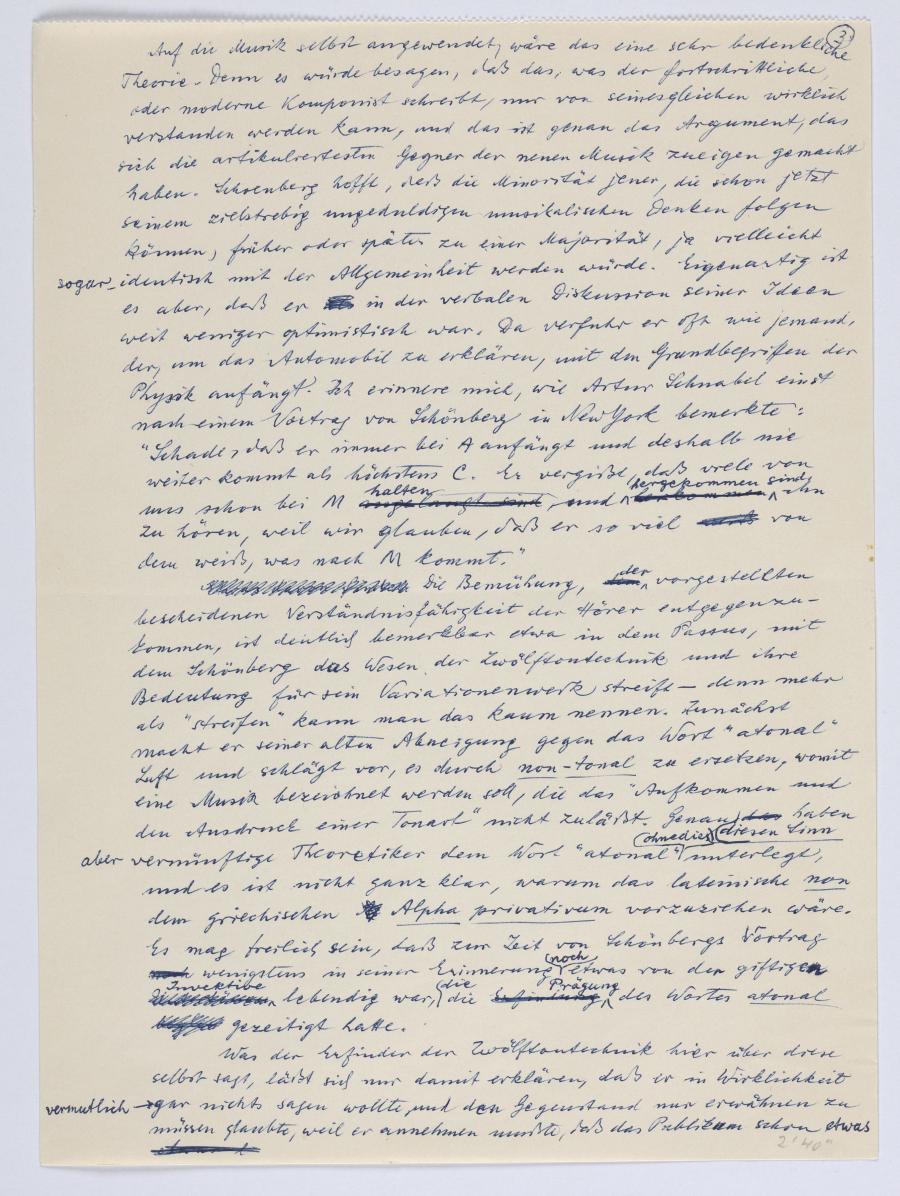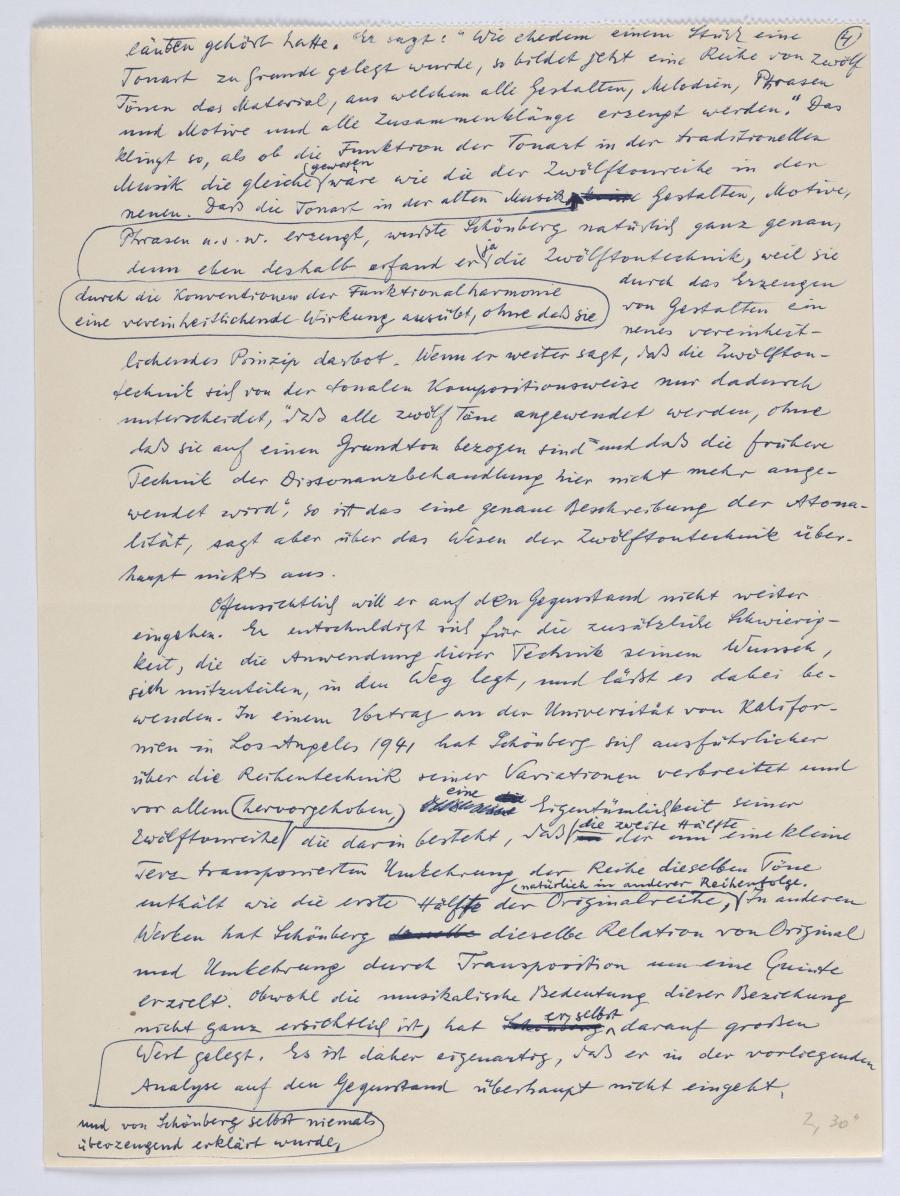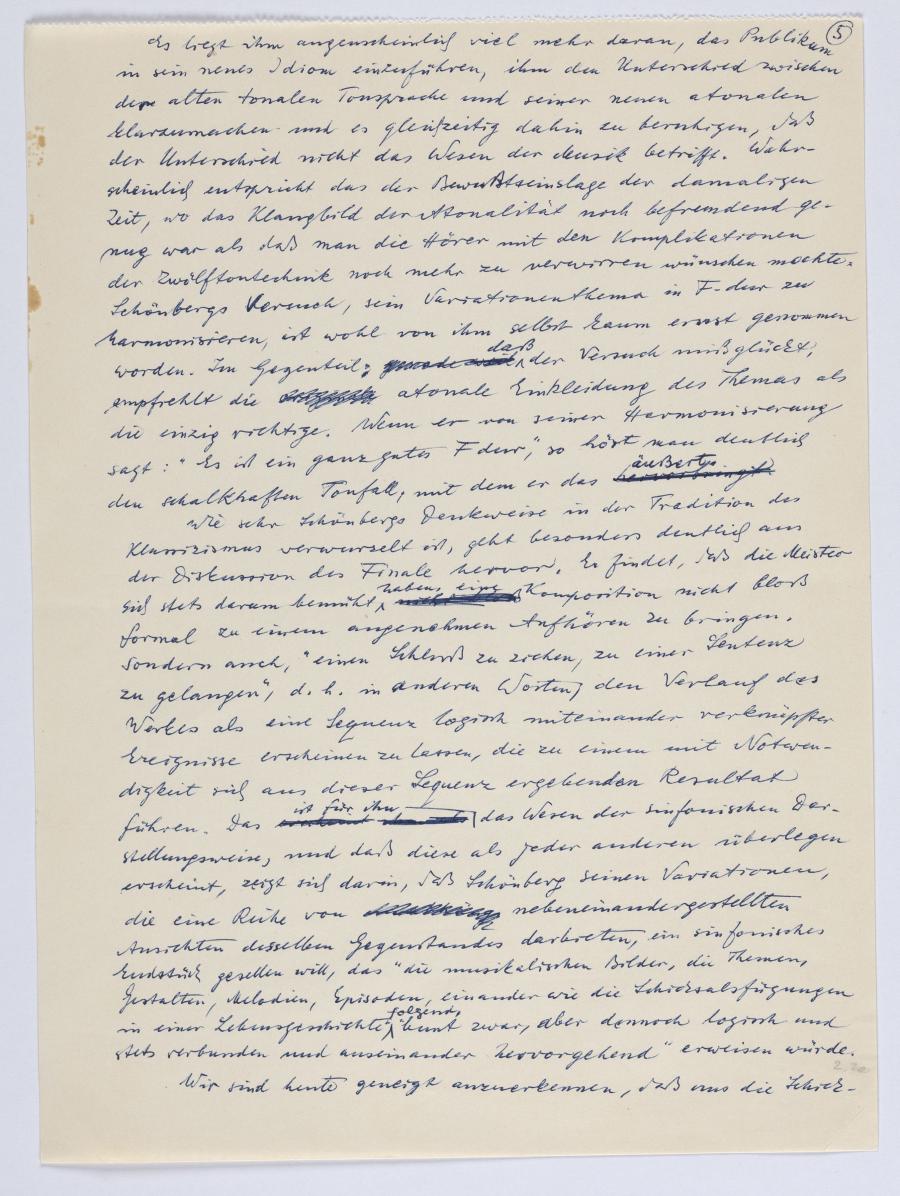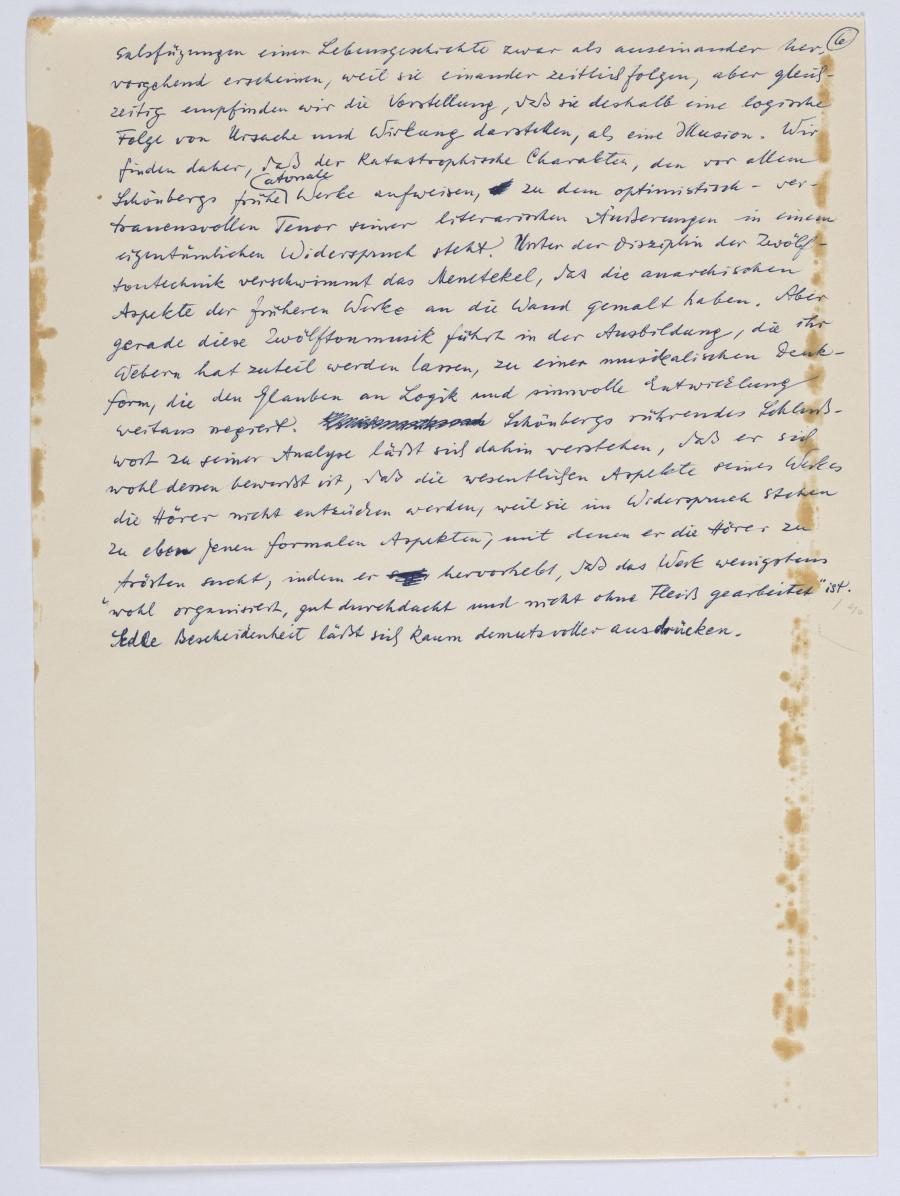[Einführungsvortrag zu Arnold Schoenberg's Orchestervariationen opus 31]
Abstract
In einem Einführungsvortrag im Radio Hamburg im Dezember 1965 setzte sich Ernst Krenek mit Arnold Schönbergs eigener, ausführlichen Analyse seiner Orchestervariationen op. 31 auseinander. Mit größter Ehrfurcht beschreibt Krenek Schönberg als Komponist, der „eine Revolution des musikalischen Denkens, Schaffens, Erlebens eingeleitet hat, die in der Musikgeschichte ihres gleichen sucht.“ Trotzdem spart er nicht mit kritischen Kommentaren, die zwar weder das Werk, noch Schönbergs Status als Komponist schmälern, sondern vielmehr Schönbergs 1931 formulierten Einschätzung der Schwierigkeiten des Publikums mit Neuer Musik Gedanken entgegenhalten, die zum einen Kreneks eigene Erfahrungen mit diesen Schwierigkeiten widerspiegeln, zum anderen sicher auch die zeitliche Distanz zwischen Schönbergs und Kreneks Vortrag deutlich machen.
Daraus erklärt sich, daß er sich einerseits als einsamen,
mit göttlichem Auftrag ausgerüsteten Pionier in unbekanntem,
gefahrvollen Territorium sieht, anderseits aber stets betont,
daß seine Entdeckungen keineswegs absurd sind, sondern
sich mit zwingender Logik aus der erhabenen Tradition
ableiten lassen, so daß sie
Es kann nicht ausbleiben, daß diese widerstreitenden Vor-
aussetzungen den furchtlosen Denker in mancherlei
Schwierigkeiten verwickeln. Diese treten schon in seinen
einleitenden Überlegungen auf. Er unterscheidet Recht
und Macht der Mehrheit und weist darauf hin, daß die Mehrheit zur nsagt in Anspruch nimmt sein Anspruch auf
Kompensation für ausgestandene Gefahr, sondern es ist das
der
2
Wenn Werke nicht, wassie sind Madame Butterflys Werk
Die selbe ist die zu lassen
3
Auf die Musik selbst angewendet, wäre das eine sehr bedenkliche
Theorie. Denn es würde besagen, daß das, was der fortschrittliche
oder moderne Komponist schreibt, nur von seinesgleichen wirklich
verstanden werden kann, und das ist genau das Argument, das
sich die artikuliertesten Gegner der neuen Musik zueigen gemacht
haben. angelangt sind herkommen
dem non-tonal zu ersetzen, womit
eine Musik bezeichnet werden soll, die das "Aufkommen und
den Ausdruck einer Tonart" nicht das habennon
dem griechischen Alpha privativum vorzuziehen wäre.
Es mag freilich sein, daß zur Zeit von Erfindung atonal
Was der Erfinder der Zwölftontechnik hier über diese
selbst sagt, läßt sich nur damit erklären, daß er in Wirklichkeit
4
läuten gehört hatte. Er sagt: "Wie ehedem einem Stück eine
Tonart zu Grunde gelegt wurde, so bildet jetzt eine Reihe von zwölf
Tönen das Material, aus welchem alle Gestalten, Melodien, Phrasen
und Motive und alle Zusammenklänge erzeugt werden." Das
klingt so, als ob die Funktion der Tonart in der traditionellen
Musik die keine Gestalten,
Offensichtlich will er auf den Gegenstand nicht weiter
eingehen. Er entschuldigt sich für die zusätzliche Schwierig-
keit, die die Anwendung dieser Technik seinem Wunsch,
sich mitzuteilen, in den Weg legt, und läßt es dabei be-
wenden. In einem Vortrag an der Universität von Kalifor-
nien in daß eine diein der um eine
5
Es liegt ihm augenscheinlich viel mehr daran, das Publikum
in sein neues Idiom einzuführen, ihm den Unterschied zwischen
der alten tonalen Tonsprache und seiner neuen atonalen
klarzumachen und es gleichzeitig dahin zu beruhigen, daß
der Unterschied nicht das Wesen der Musik betrifft. Wahr-
scheinlich entspricht das der Bewußtseinslage der damaligen
Zeit, wo das Klangbild der Atonalität noch befremdend ge-
nug war als daß man die Hörer mit den Komplikationen
der Zwölftontechnik noch mehr zu verwirren wünschen mochte.
gerade weil hervorbringt
Wie sehr nicht bloß Kompositionerscheint ihm als
Wir sind heute geneigt anzuerkennen, daß uns die Schick-
6
salsfügungen einer Lebensgeschichte zwar als auseinander her-
vorgehend erscheinen, weil sie einander zeitlich folgen, aber gleich-
zeitig empfinden wir die Vorstellung, daß sie deshalb eine logische
Folge von Ursache und Wirkung darstellen, als eine Illusion. Wir
finden daher, daß der katastrophische Charakter, den vor allem